Das Institut für Didaktik der Demokratie der Leibniz Universität Hannover hat zum Ziel, Forschungs- und Transferaktivitäten auf den Feldern von Politischer Bildung und Demokratiepädagogik, Geschichte und Erinnerungskultur sowie den sozialen Herausforderungen der Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts zu bündeln und zu profilieren. Wir haben eine der leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen interviewt:
Liebe Frau Dr. Elisaveta Firsova-Eckert, was sind Ihrer Meinung nach Gründe, weshalb Menschen an Verschwörungserzählungen glauben?
Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Aktuelle Forschungsbefunde und theoretische Auseinandersetzungen verweisen dabei auf verschiedene Faktoren. Psychologisch spielen Bedürfnisse nach Sicherheit und Kontrolle in unsicheren Zeiten eine wichtige Rolle. Auf sozialer Ebene kann der Glaube an Verschwörungen eine positive Selbstwahrnehmung stützen, etwa durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich als „wissender“ oder „kritischer“ gegenüber den vermeintlich naiven Eliten oder der Mehrheitsgesellschaft versteht. Hinzu kommen identitäts- und sinnstiftende Motive sowie existenzielle Gründe – etwa der Wunsch, sich in einer komplexen, unsicheren und mehrdeutigen Welt an Klarheit und Eindeutigkeit festhalten zu können.
Darüber hinaus geht man heute davon aus, dass es eine Art Verschwörungsmentalität gibt – eine relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft, die mit einer kognitiven Offenheit für die Idee verbunden ist, dass „hinter allem“ eine Verschwörung steckt. Wer an eine Verschwörungstheorie glaubt, ist daher häufig auch für weitere anfällig, selbst wenn diese sich inhaltlich widersprechen.
Gleichzeitig dürfen diese Erklärungsansätze nicht darüber hinwegtäuschen, dass sicherlich noch viele psychologische Prädispositionen und Einstellungen, die den Glauben an Verschwörungstheorien beeinflussen, bislang nicht hinreichend erforscht sind. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf. Hinzu kommt, dass wir aktuell in gesellschaftlich und politisch instabilen Zeiten leben, die zudem stark digital geprägt sind. Diese Konstellation wirkt wie ein Brennglas: Sie fördert die Verbreitung von Verschwörungstheorien und trägt zugleich dazu bei, dass diese gesellschaftlich bereitwilliger akzeptiert werden.
Sie haben sich wissenschaftlich mit dem Wirken von Demokratiebildung an niedersächsischen Schulen befasst. Wie kann Bildungsarbeit Verschwörungsdenken an Schulen begegnen?
Bei der Studie „DebiS“: Die DemokratibildungsStudie Niedersachsen haben wir uns angeschaut, inwieweit der Demokratiebildungserlass aus dem Jahr 2021 dazu geführt hat, dass Lehrkräfte sich bestätigt gefühlt haben, Demokratiebildung aktiv zu betreiben, und auch ihre generellen Einstellungen und Vorstellungen zu zentralen Demokratiebildungsaspekten erfasst. Auch bei Verschwörungstheorien kann man natürlich mit Steuerungselementen wie Erlassen, z. B. zur Förderung der digitalen Medienkompetenz, vorgehen. Ich denke aber, dass das nur die Oberfläche berühren würde und auch viele Lehrpersonen überfordern könnte, sich auf einmal – als Querschnittsaufgabe – in ein doch sehr spezifisches Feld einzuarbeiten.
Zentral ist im Umgang mit Verschwörungstheorien deshalb das Thema Prävention. Studien zeigen, dass Interventionen nur begrenzt wirksam sind. Prävention bedeutet hingegen, Lernende frühzeitig in die Lage zu versetzen, Muster von Verschwörungsdenken zu erkennen, deren Attraktivität kritisch zu reflektieren und alternative Deutungen zu entwickeln. Hierbei könnten mehrere Ansatzpunkte eine Rolle einnehmen, wie z. B.:
Kritisches Denken und Argumentationsfähigkeit: Schülerinnen und Schüler sollten üben, Informationen zu hinterfragen, Widersprüche zu erkennen und eigene Positionen argumentativ abzusichern.
Medien- und Informationskompetenz: Gerade die Rolle sozialer Medien als Resonanzraum für Verschwörungserzählungen muss stärker in den Blick genommen werden – wie funktionieren Algorithmen, Desinformationskampagnen, wie vermitteln verschwörungstheoretische Influencer und was sind klassische verschwörungstheoretische Codes?
Demokratiepädagogische Erfahrungen: Demokratiebildung bleibt nicht bei der Wissensvermittlung stehen, sondern eröffnet Erfahrungsräume, in denen Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeit erleben, Teilhabe praktizieren und demokratische Aushandlungsprozesse nachvollziehen können. Das stärkt Resilienz gegenüber einfachen, verschwörungsideologischen Erklärungsmustern.
Was wünschen Sie sich als Wissenschaftlerin für die Fortentwicklung des Präventionsfelds im Bereich Verschwörungsdenken und Verschwörungserzählungen?
Zum einen halte ich eine stärkere Wirkungsforschung für notwendig. Zwar gibt es bereits viele gute und spannende Initiativen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Verschwörungstheorien, doch wissen wir bislang nur wenig darüber, ob sie tatsächlich die intendierte Wirkung entfalten und wie nachhaltig ihre Effekte sind. Eine systematische Begleitforschung, die Maßnahmen und ihre Zielgruppen über einen längeren Zeitraum in den Blick nimmt, könnte hier wichtige Erkenntnisse liefern und bislang wenig erschlossene Bereiche erhellen.
Ein zweiter Punkt betrifft die Finanzierung. Viele Initiativen existieren nur so lange, wie es die jeweilige Förderung erlaubt. Verschwörungstheorien hingegen sind robust und dauerhaft präsent – dieses Missverhältnis schwächt den präventiven Ansatz. Maßnahmen sollten daher so finanziell abgesichert sein, dass Bildungsinitiativen und Präventionsprojekte die nötige Zeit und Reichweite haben, um wirklich in der Breite anzukommen. Andernfalls profitieren lediglich einzelne Jahrgänge von den Angeboten, während nachfolgende Klassen wieder neu nach Alternativen suchen müssen. Eine verlässliche Finanzierung könnte zudem nachhaltige Kooperationen zwischen Anbietern und Schulen sichern.
Abschließend möchte ich als Forscherin mit einem Fokus auf Antisemitismus betonen, dass Präventionsmaßnahmen die enge Verbindung von Verschwörungstheorien und Antisemitismus noch stärker berücksichtigen sollten. Nahezu jede Verschwörungserzählung weist einen antisemitischen Kern auf. Dennoch werden zentrale Codes und Chiffren von vielen (Pädagog*innen als auch Lernenden) oft nicht erkannt. Eine Sensibilisierung für diese Verbindung ist besonders in der aktuellen Situation dringend geboten, in der Antisemitismus in Deutschland wieder vehementer und entgrenzter zutage tritt.
Vielen Dank für Ihre Zeit!

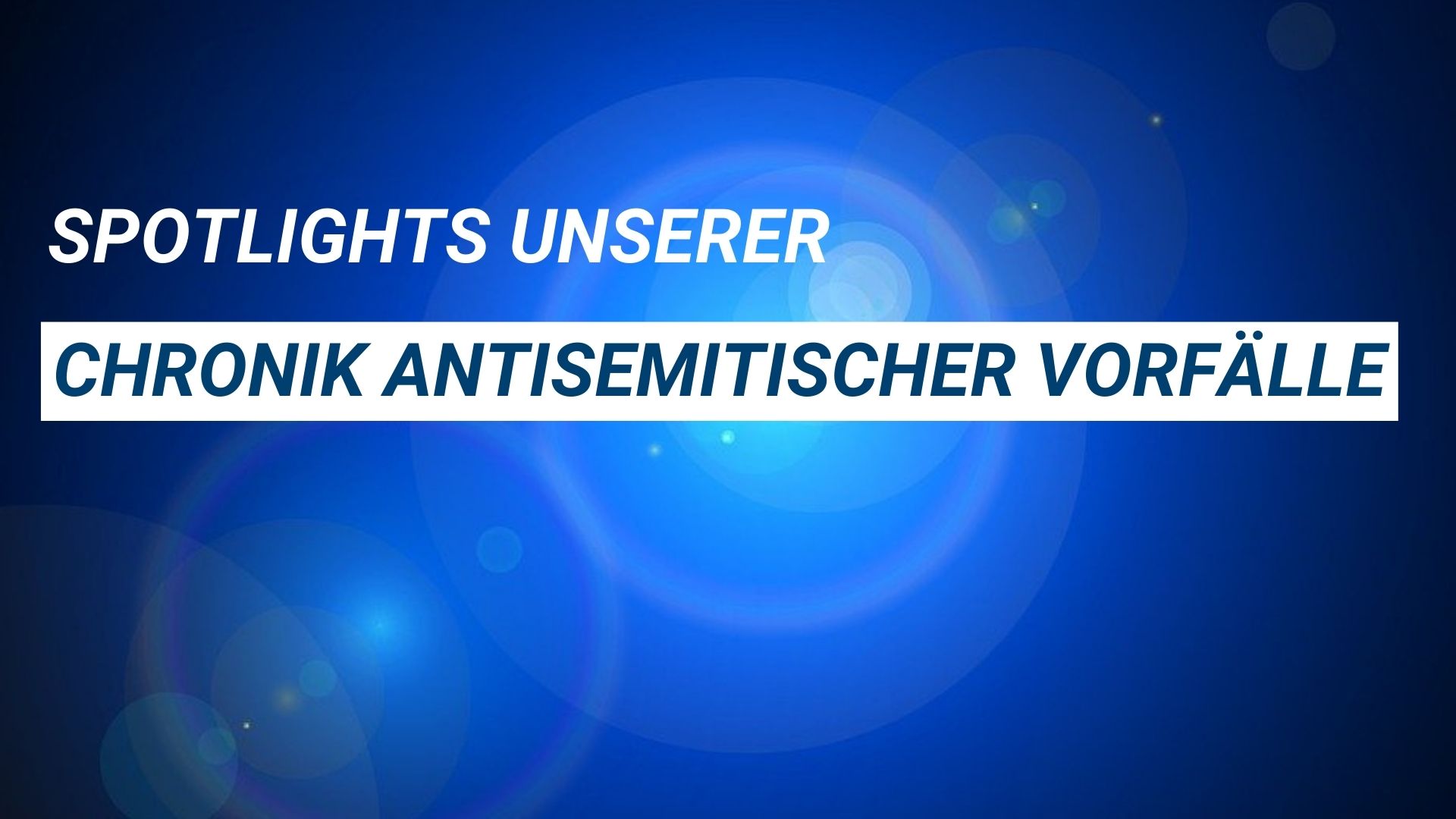
![Aktionswochen_[transfer]_Header_ohne Logos klein](https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2023/11/transfer_Header_ohne-Logos-klein.png)
