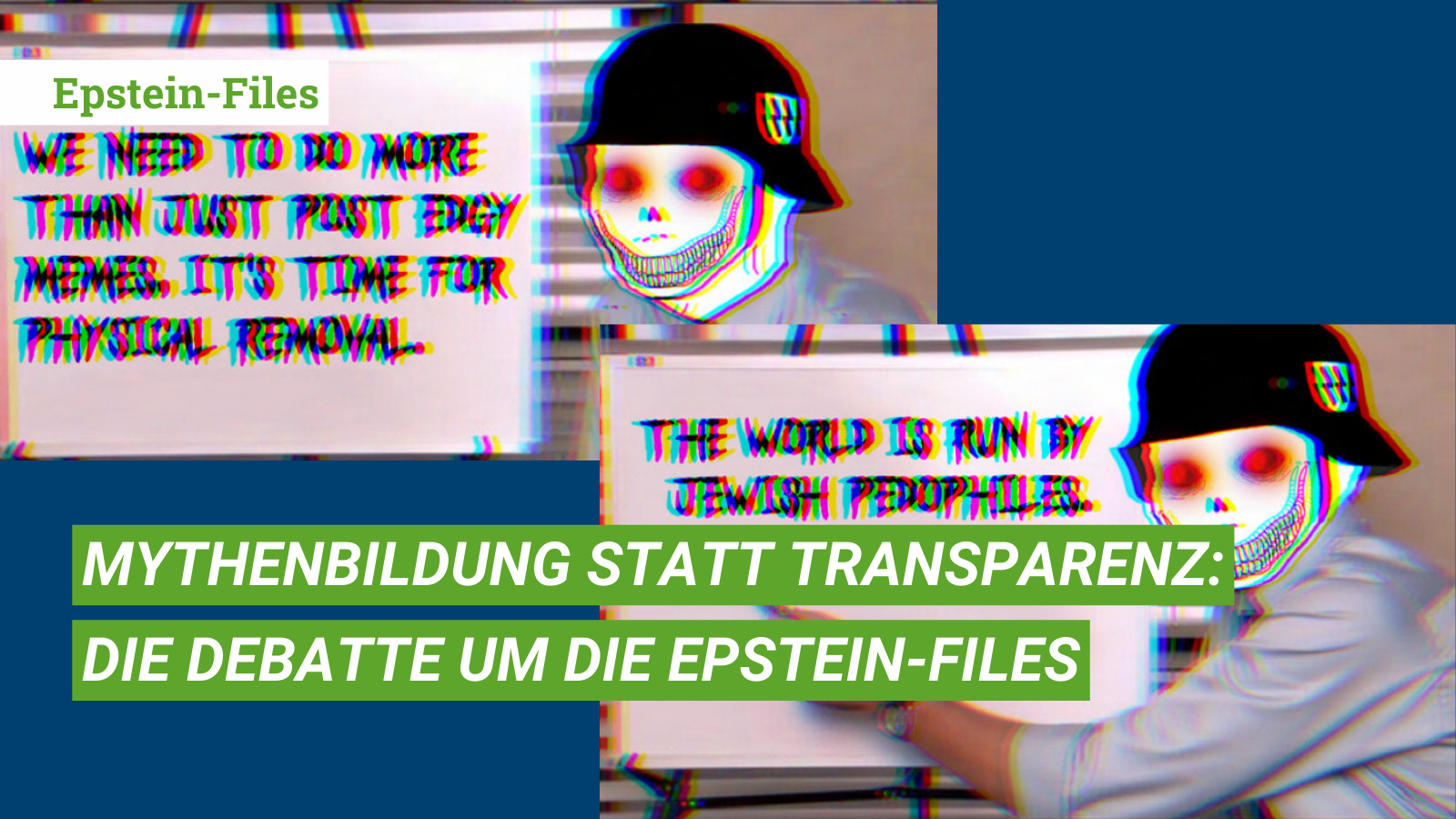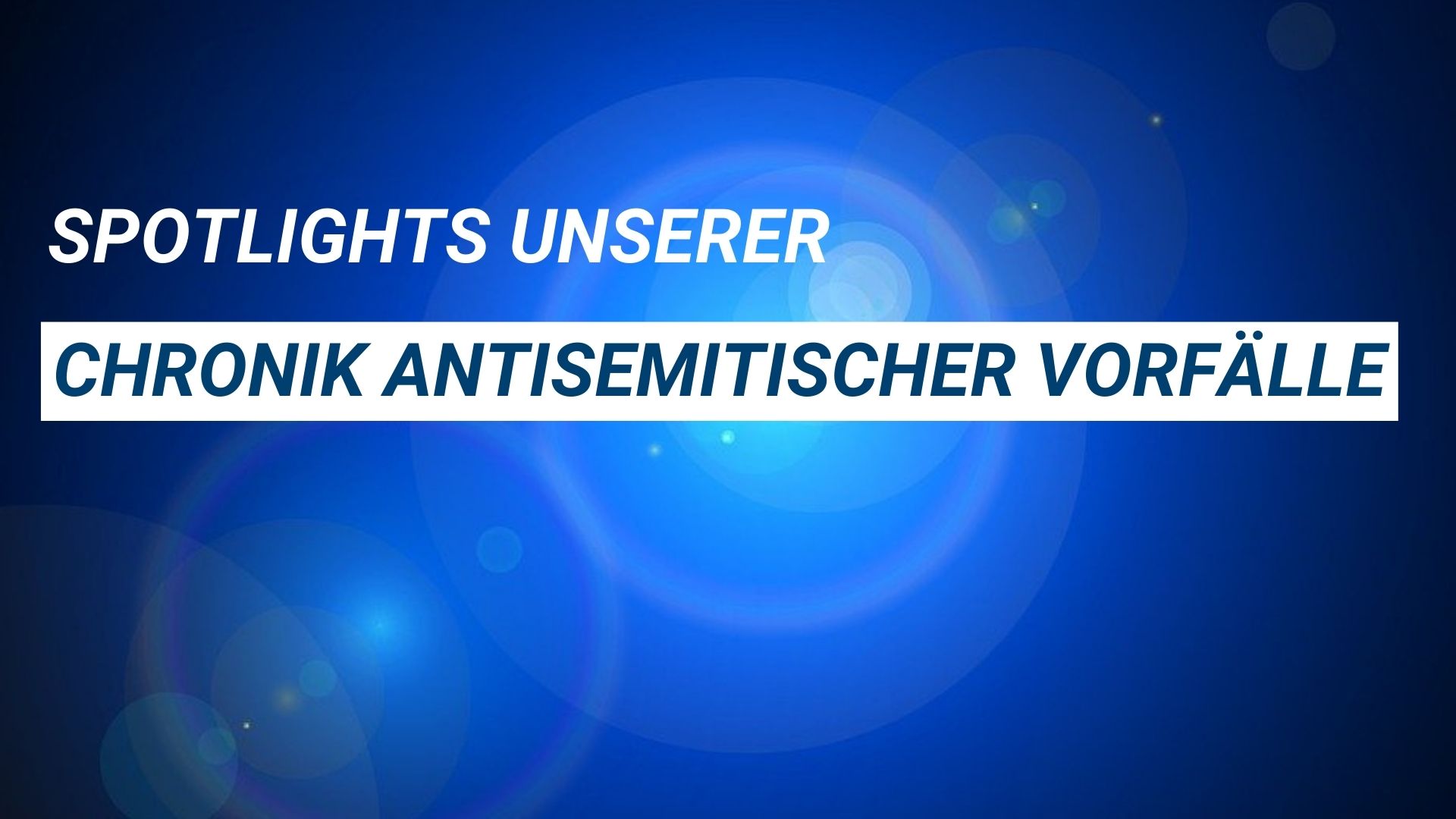Gefühle prägen das menschliche Welt- und Selbstverhältnis auf vielfältige Weise, ob hintergründig als diffuse Stimmungen oder akut als konkretes Gefühlserlebnis. Sie sind Gegenstand individueller wie kollektiver Regulierung, normativer Bewertung und zwischenmenschlicher Kommunikation. Gefühle tragen so auf fundamentale Weise zu der Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens bei. Und in diesem Sinne sind sie auch relevant für eine Erforschung und Bekämpfung des Antisemitismus. Dieser Umstand wurde nach den antisemitischen Massakern der Hamas vom 7. Oktober 2023 besonders deutlich, als Jüdinnen und Juden das Ausbleiben uneingeschränkter Anteilnahme und Empörung beklagten. Hier zeigt sich die zentrale Rolle, die die sogenannten moralischen Gefühle im Zwischenmenschlichen einnehmen und inwiefern sich Antisemitismus auch auf dieser Ebene auswirken kann.
Johanna Bach hat Soziologie und Philosophie in Frankfurt am Main studiert und promoviert zu dem Thema „Die Gefühlswelt des Antisemitismus“. Sie ist Promotionsstipendiatin der Rosa Luxemburg Stiftung und Mitglied des AK Antisemitismus der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Sie forscht und publiziert zu Antisemitismus, Emotionstheorie, Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien sowie zur Moralphilosophie des Nationalsozialismus. Titel der Dissertation: Die Gefühlswelt des Antisemitismus – Eine emotionstheoretische Studie antisemitischer Gefühlskonstellationen in der deutschen Geschichte und Gegenwart
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.