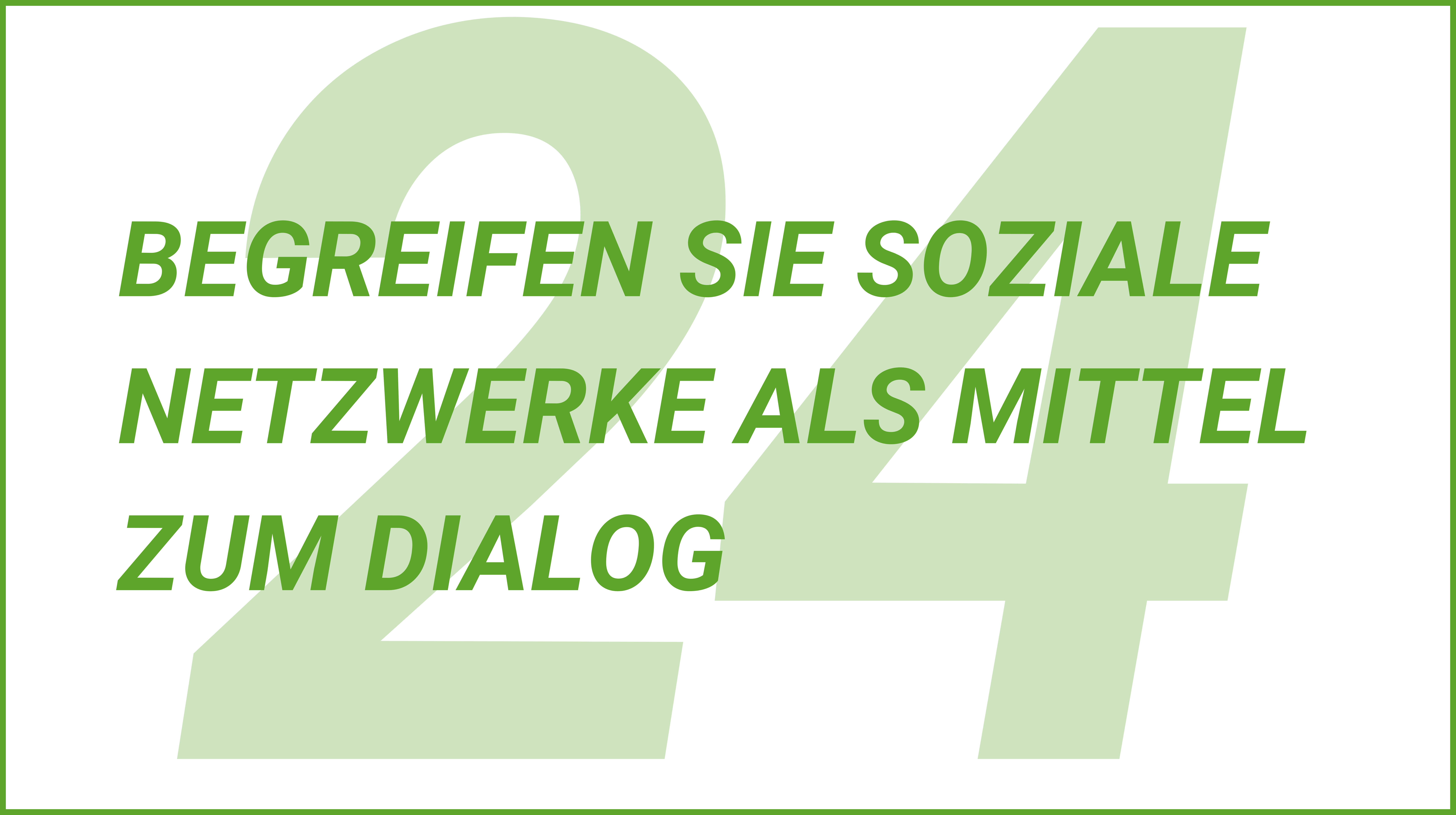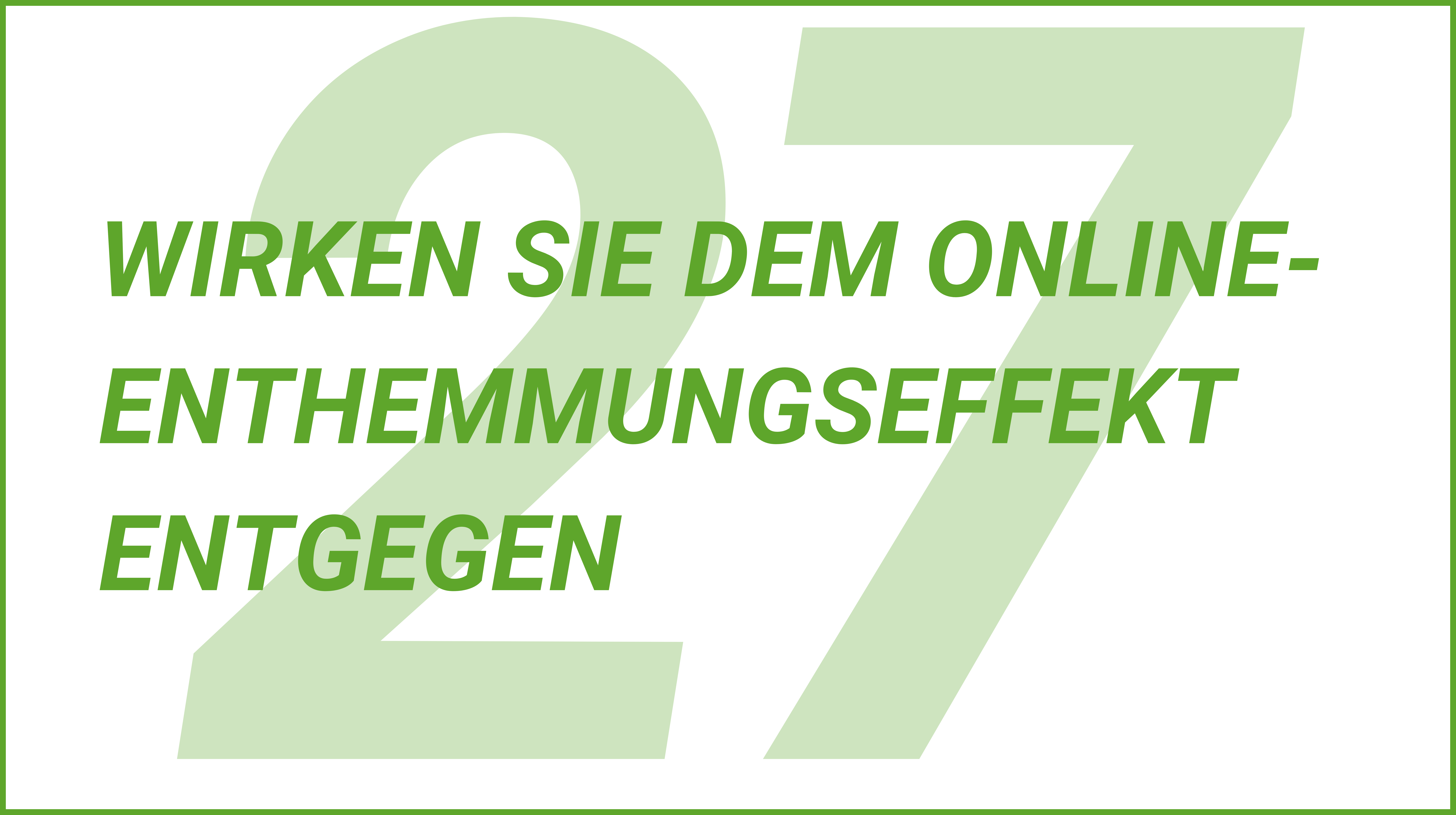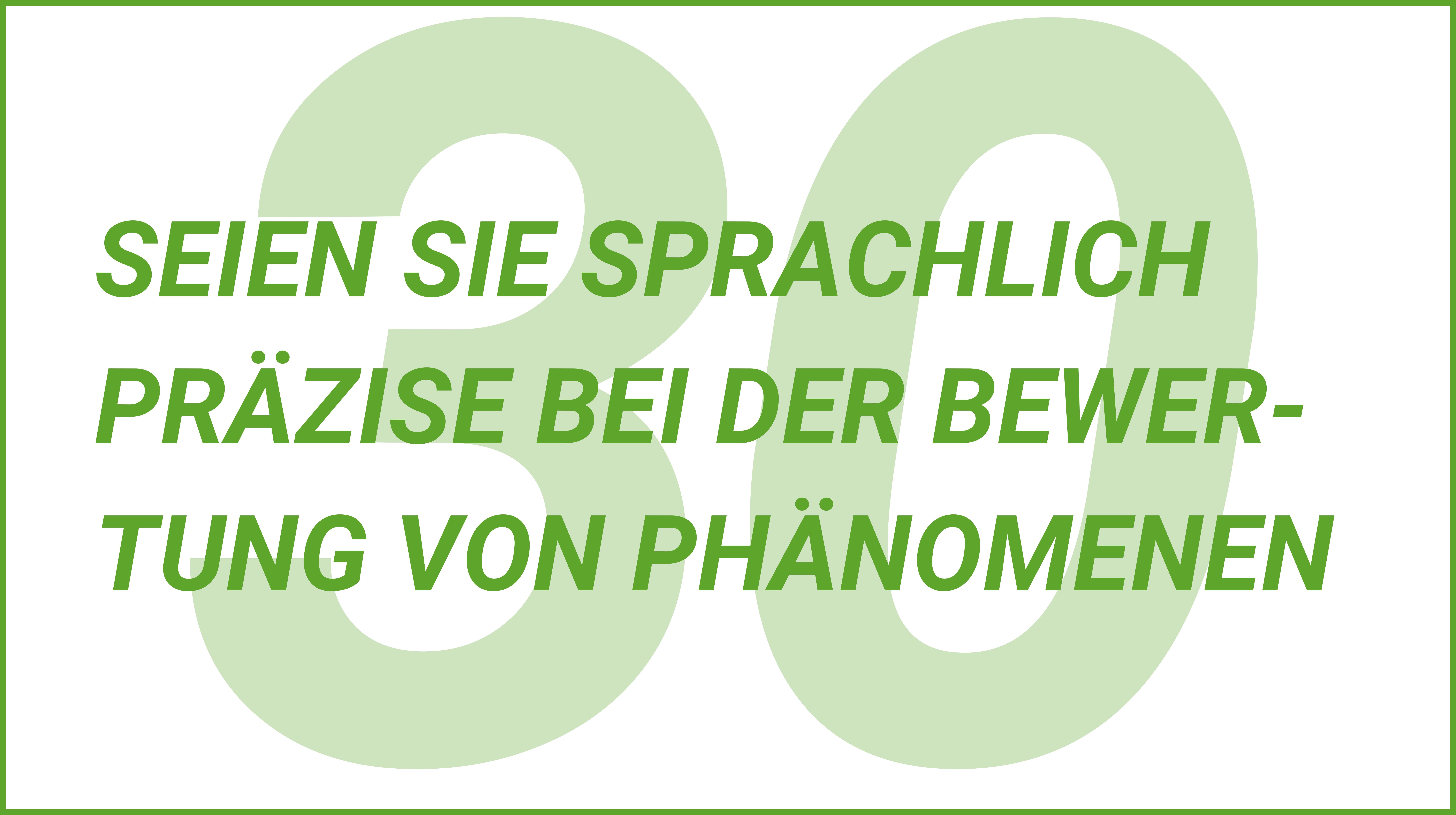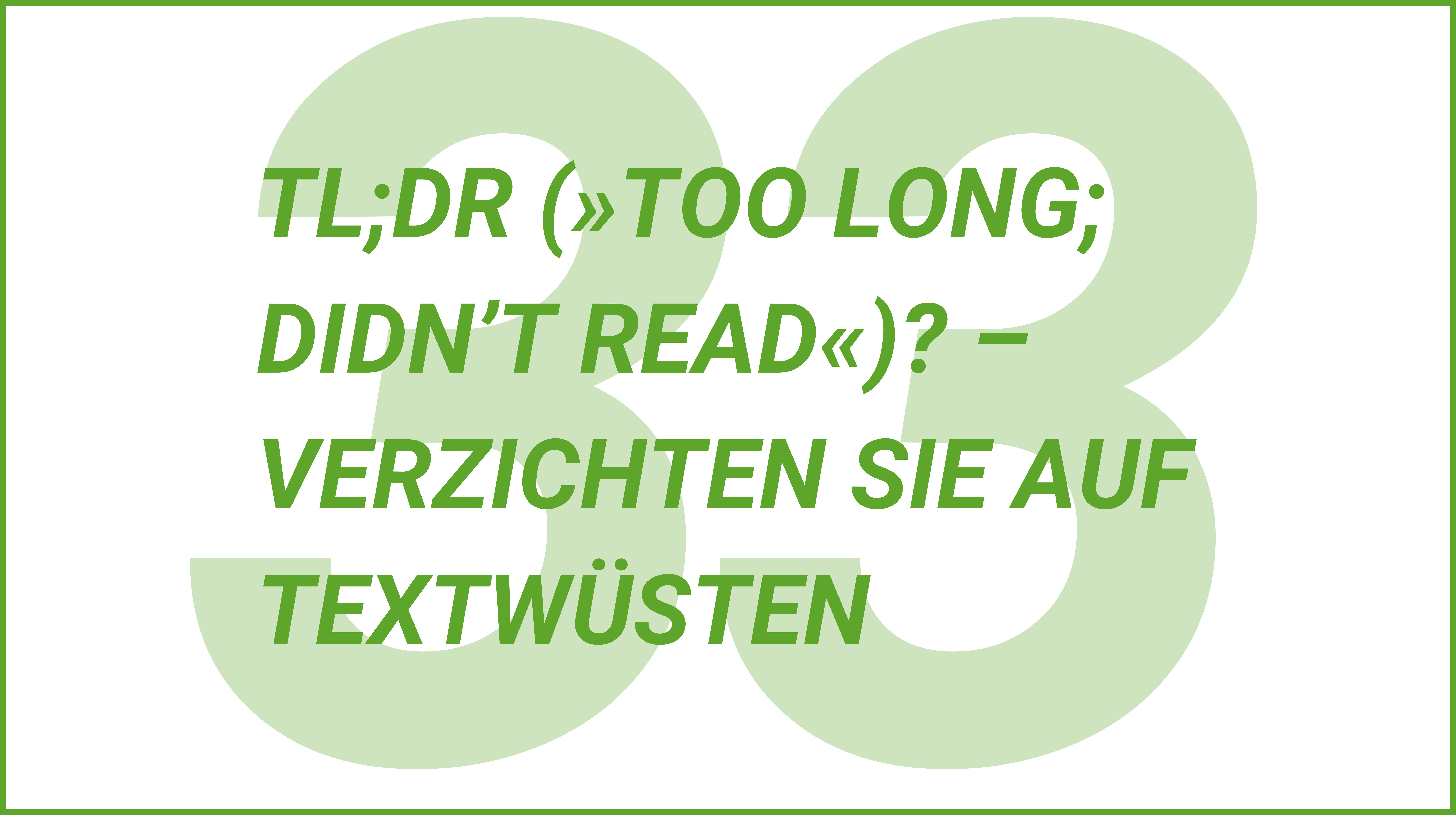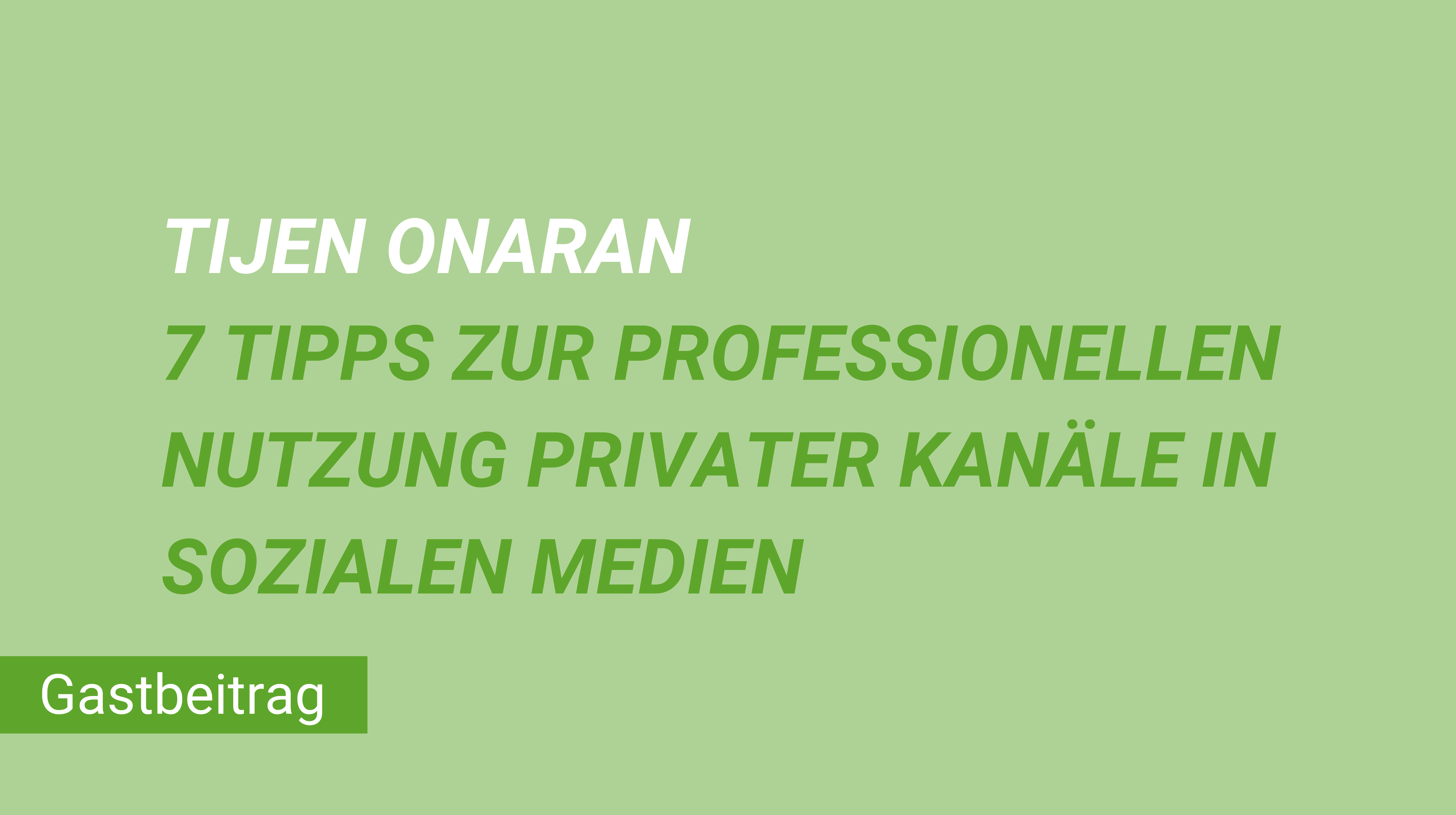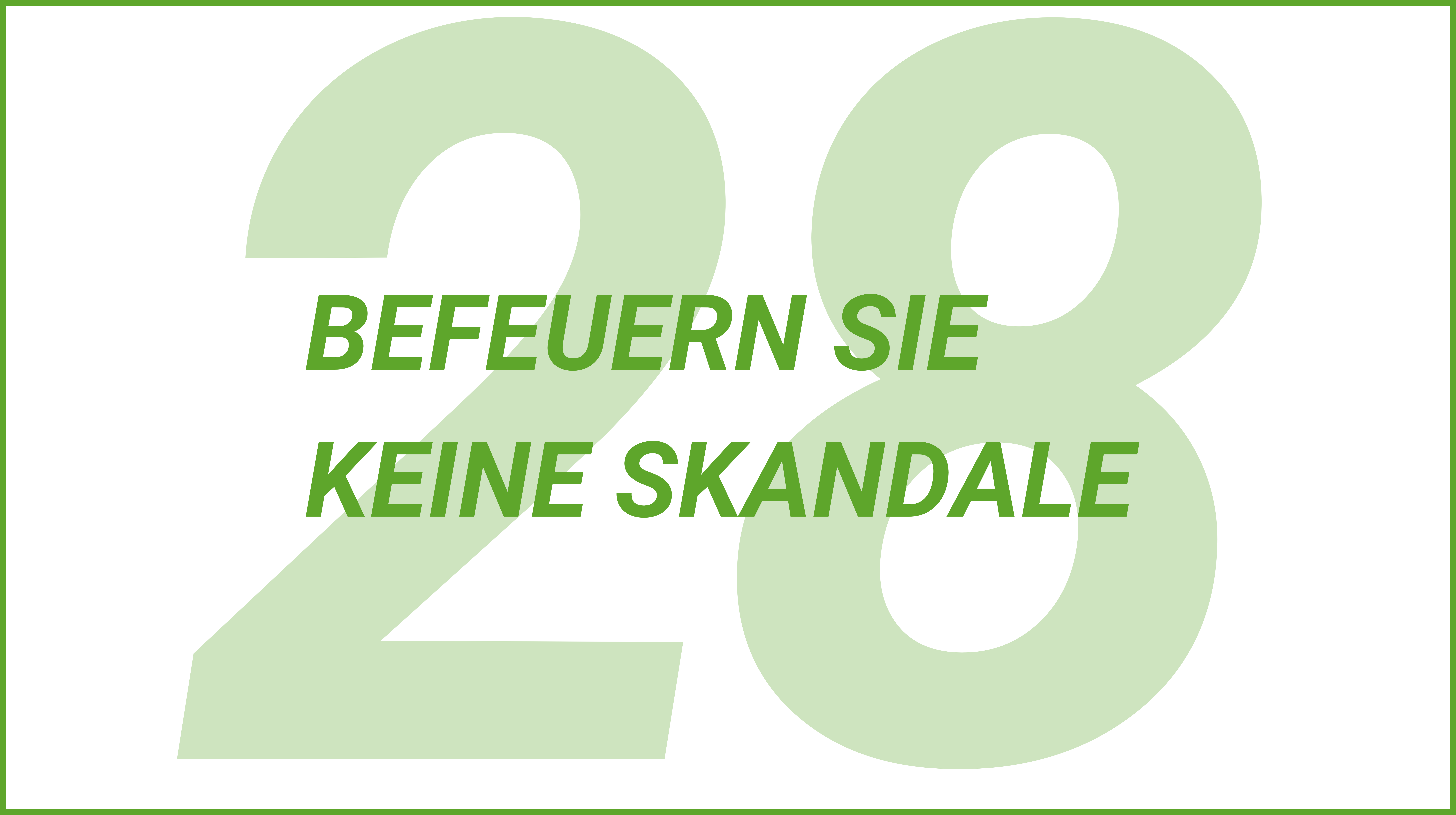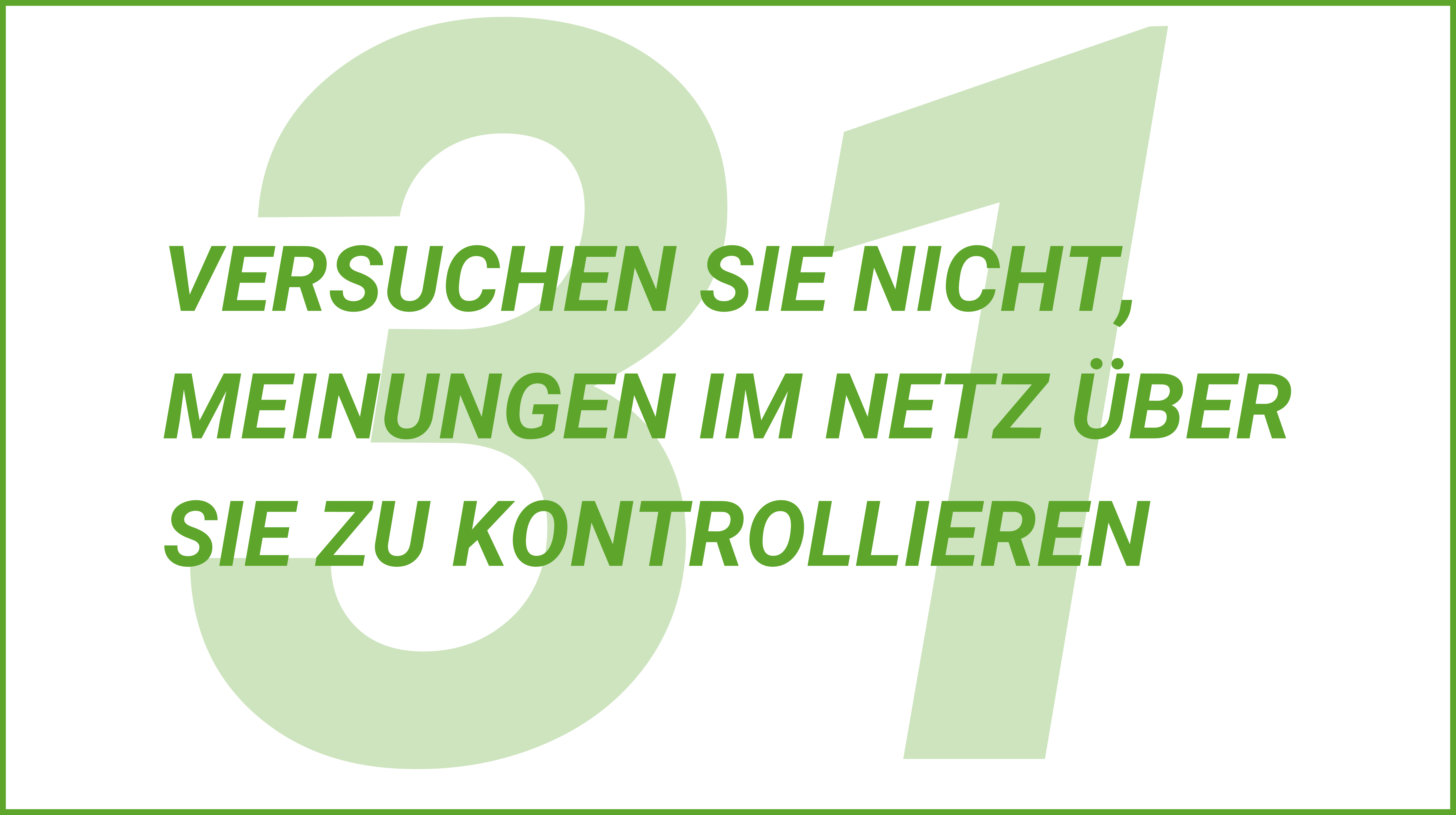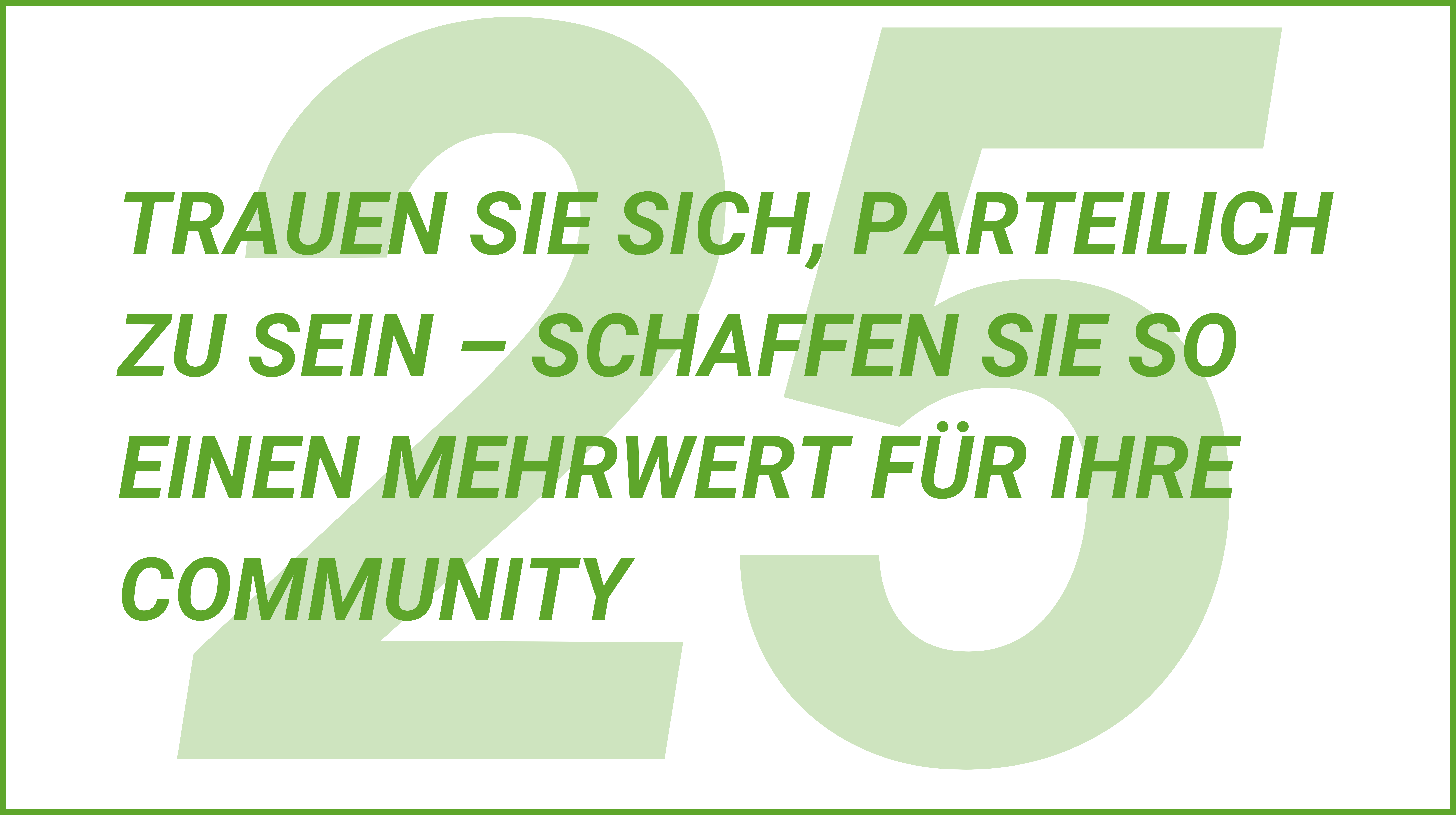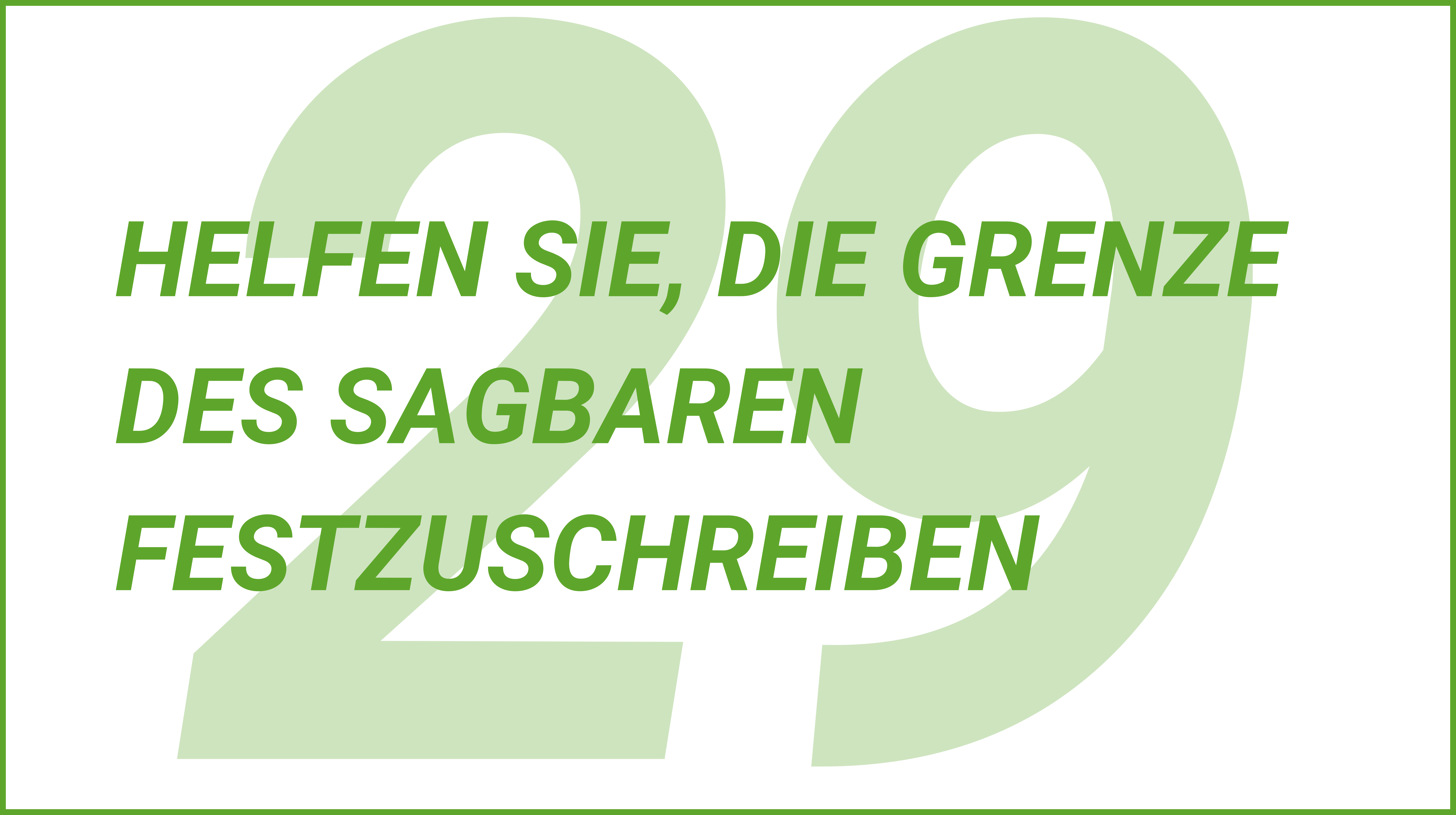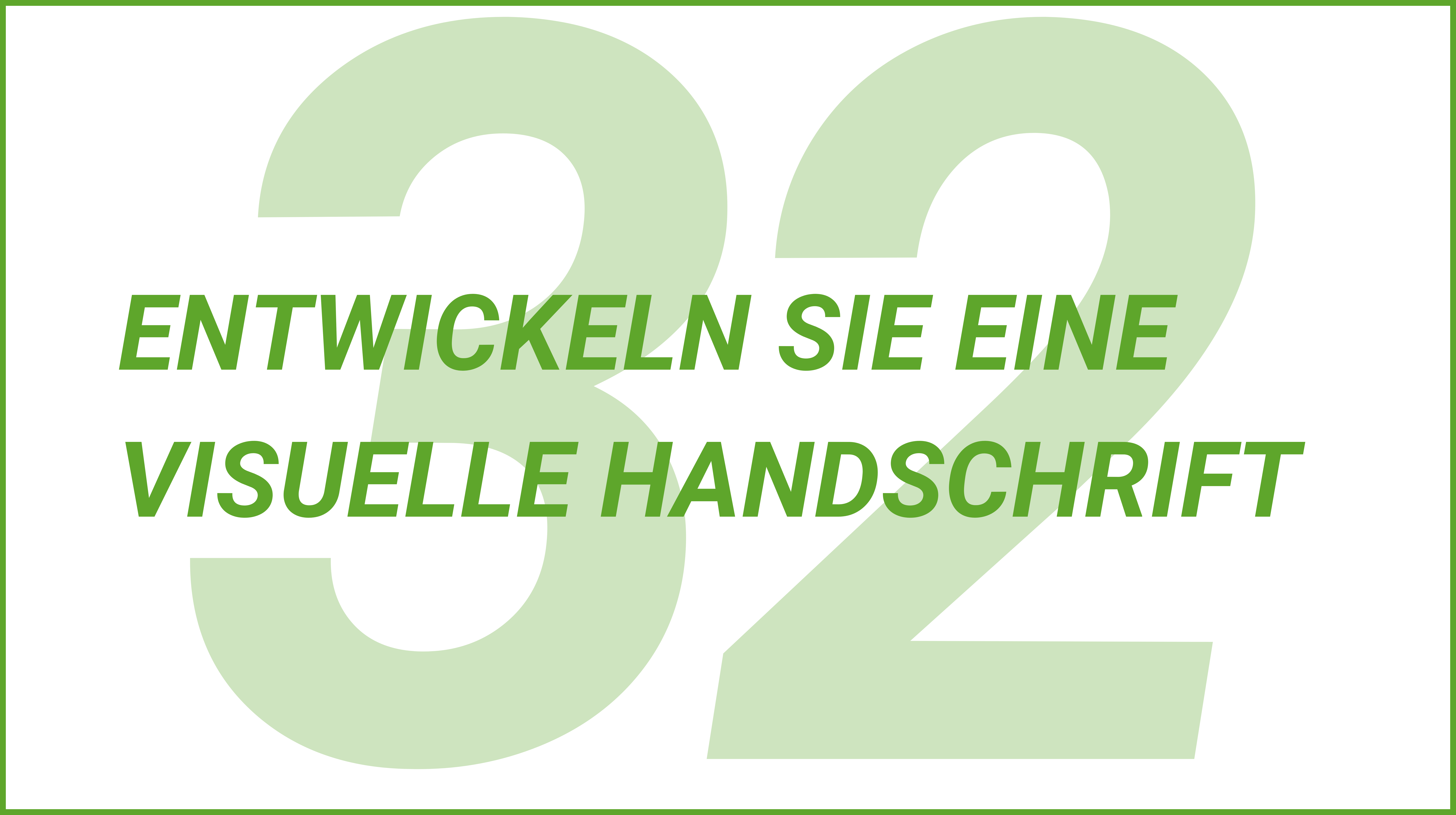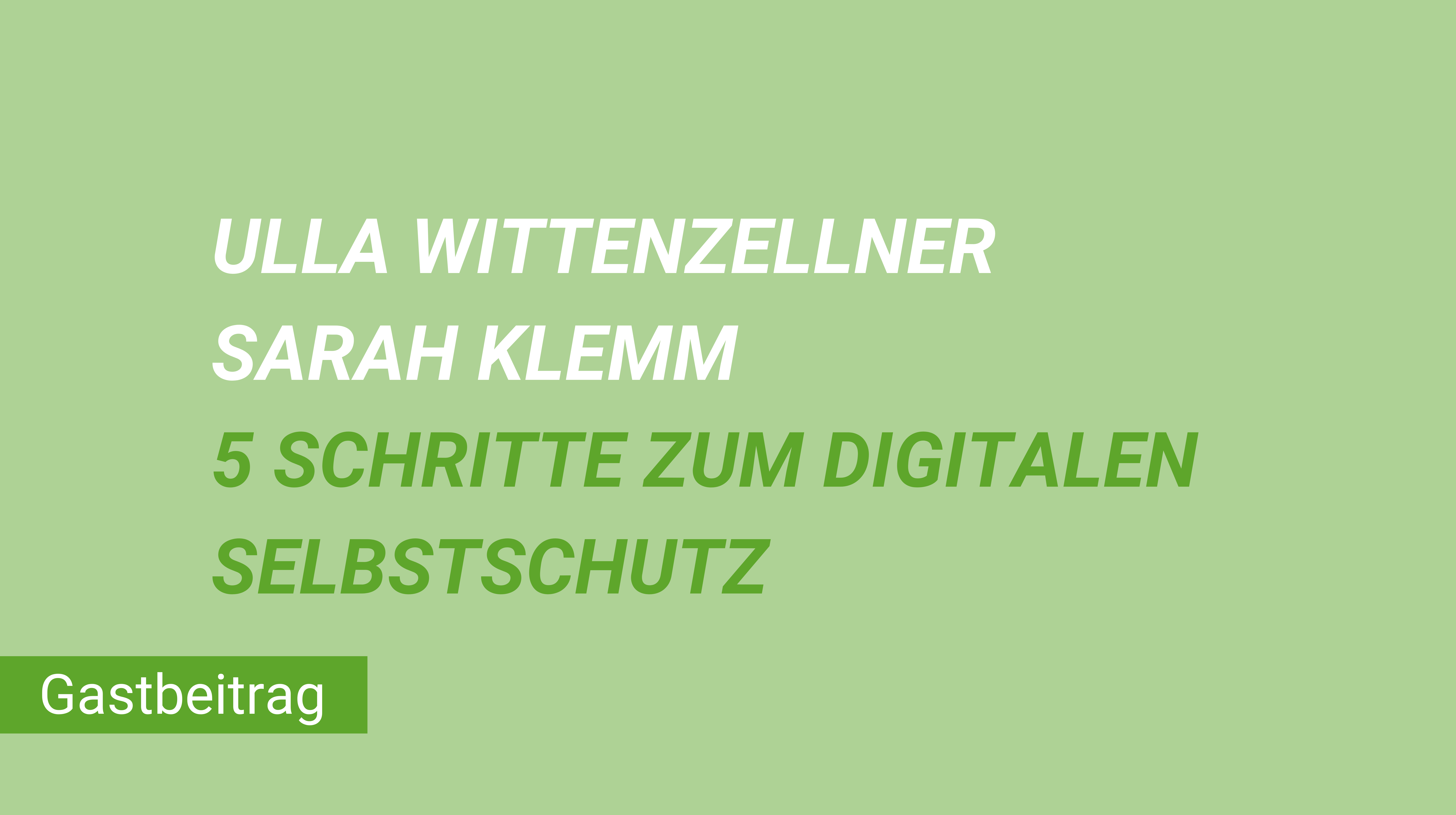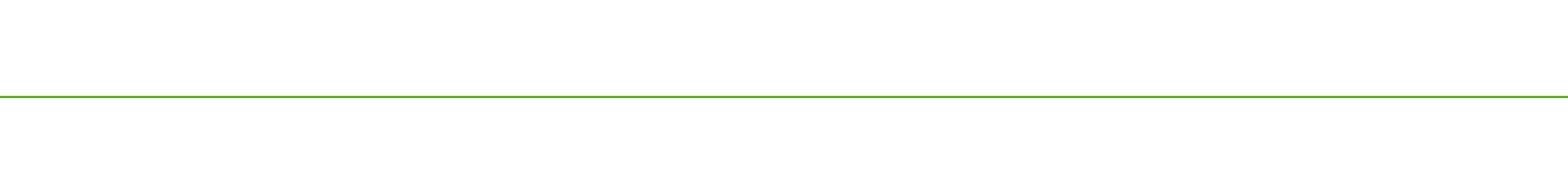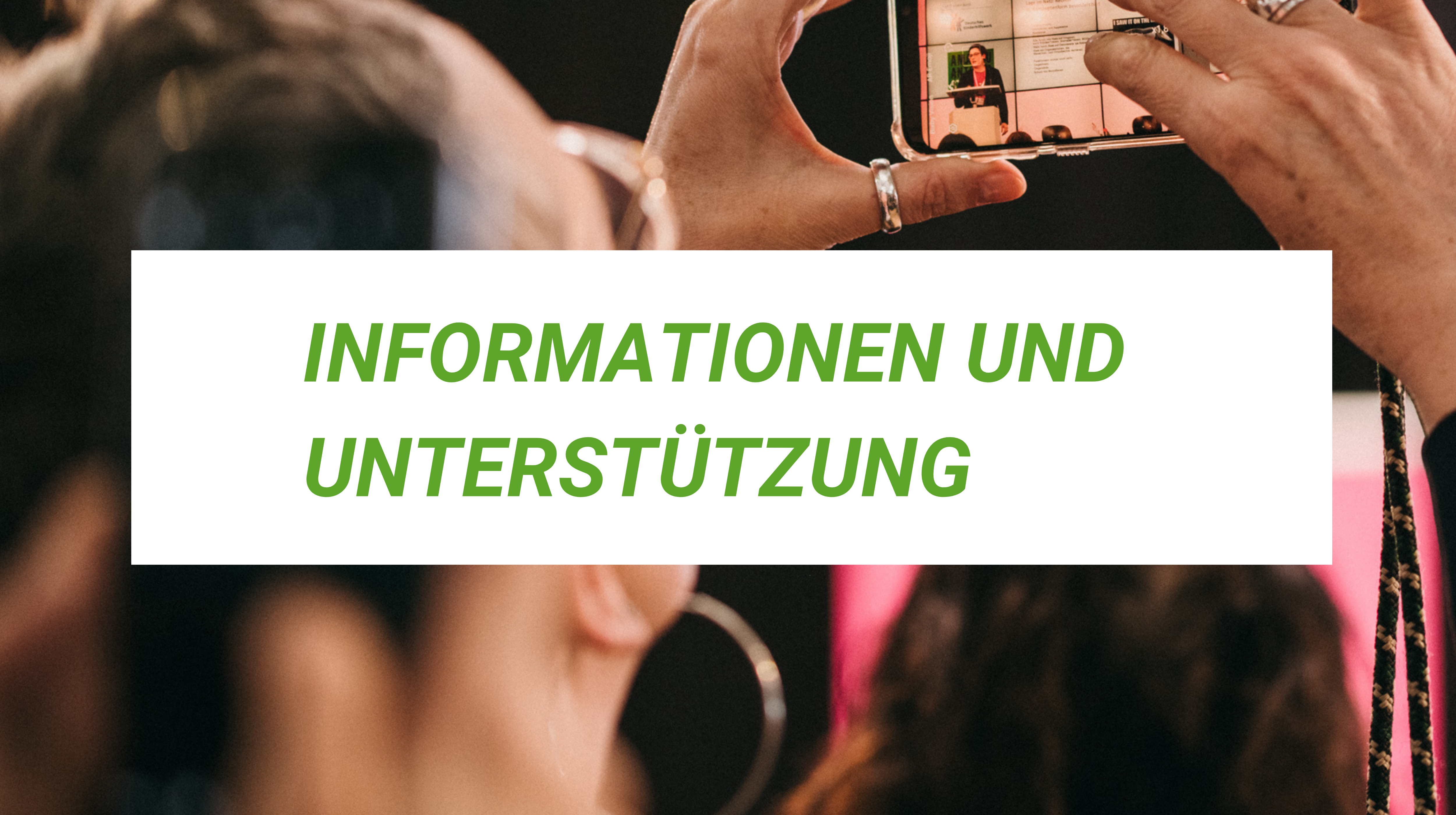Best Practice für eine Digitale Zivilgesellschaft
Best Practice für eine Digitale Zivilgesellschaft - Praxistipps zur Medienkompetenz & Netzkultur
Wie entscheidend das Wissen um die Mechanismen digitaler Räume sein kann, ließ sich sehr gut bei den Diskussionen um die Auswertung der Europawahl im Mai 2019 beobachten: Ein Video des YouTubers Rezo löste eine breite Debatte über das Verhältnis von Politik und Sozialen Netzwerken aus. Er empfahl in seinem 55 Minuten langen Video, keine Parteien zu wählen, die sich nicht ausreichend für eine andere Klimapolitik einsetzen würden. Sein Rant, quasi die elektronische Version einer Wutrede, entwickelte sich nach der Veröffentlichung zu einem YouTube-Hit: Das Video hat mit Stand November 2019 mehr als 16 Millionen Aufrufe.

Die auf die Veröffentlichung folgende Debatte drehte sich um die Fragen, warum die etablierten Parteien so wenig Erfolg im Internet haben und wie mit der Kritik von Rezo politisch und journalistisch umgegangen wer den sollte. YouTube fand im Rahmen der Debatte als Ort von Meinungsbildung, Informationsaustausch und Entscheidungsfindung endlich die nötige Anerkennung. Auch konnte hier konkret beobachtet werden, dass Social Media-Influencer*innen durchaus erfolgreich politische und gesellschaftliche Debatten anstoßen können – mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln von Video und Netzkultur und digitaler Kommunikationsinfrastruk tur. Die immer schon künstliche Trennung zwischen digitaler und analoger Welt ist daher längst obsolet ge worden. Wo früher Passant*innen auf der Straße befragt wurden, werden heute Tweets in Nachrichtensendungen eingebunden. Internationale Kampagnen und politische Bewegungen, wie #Metoo oder Fridays for Future haben im digitalen Raum ihren Ausgangspunkt.