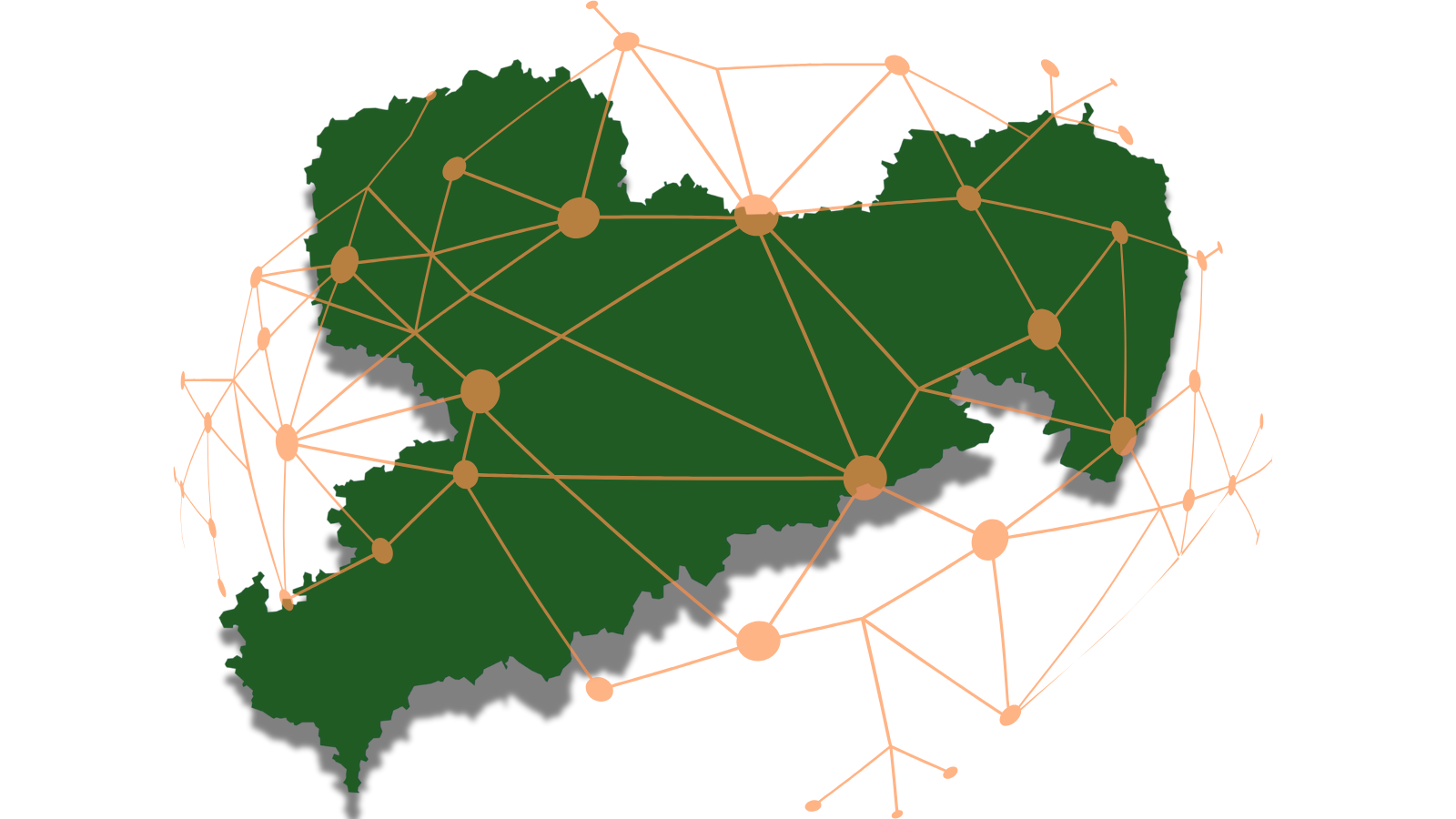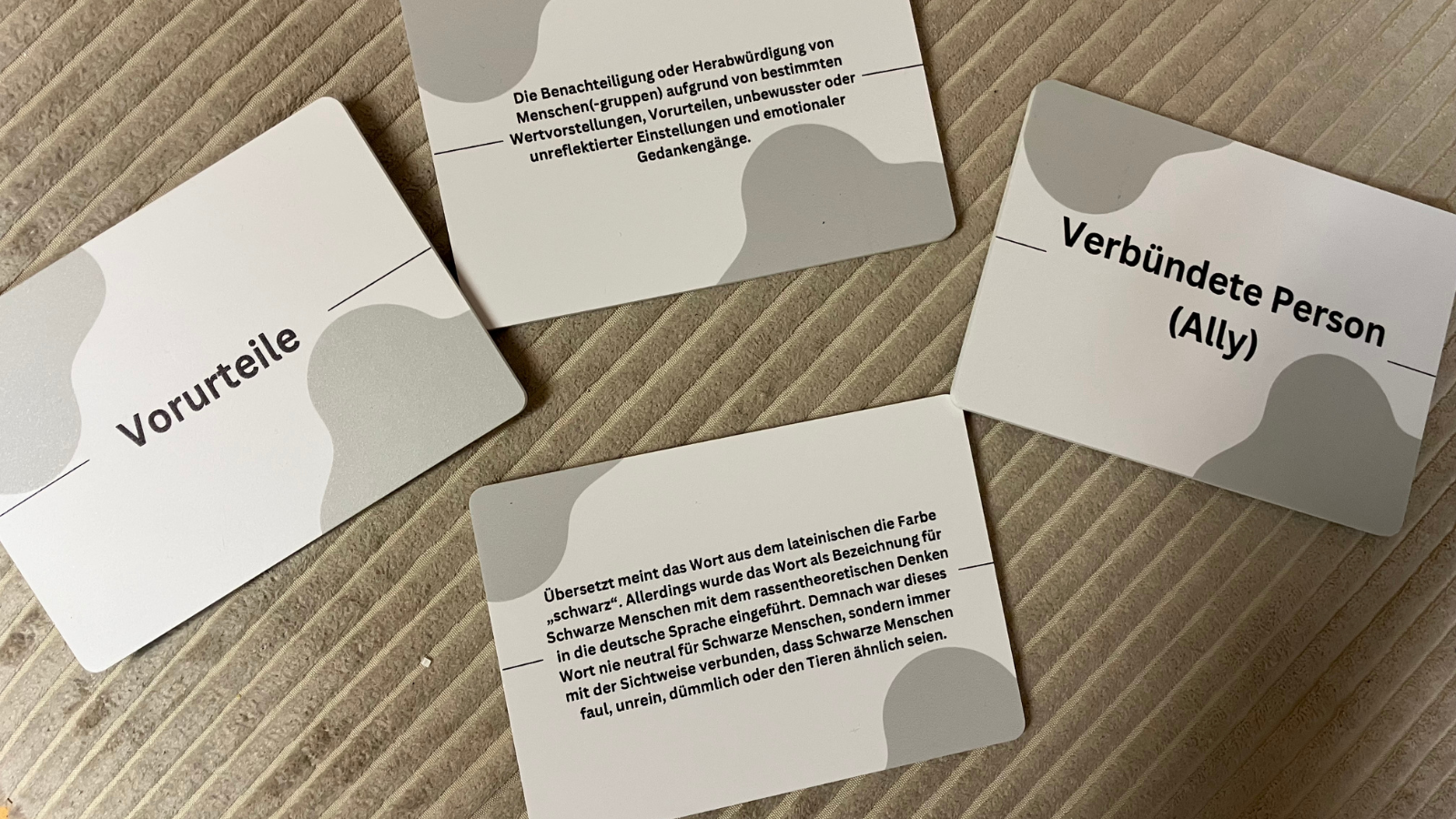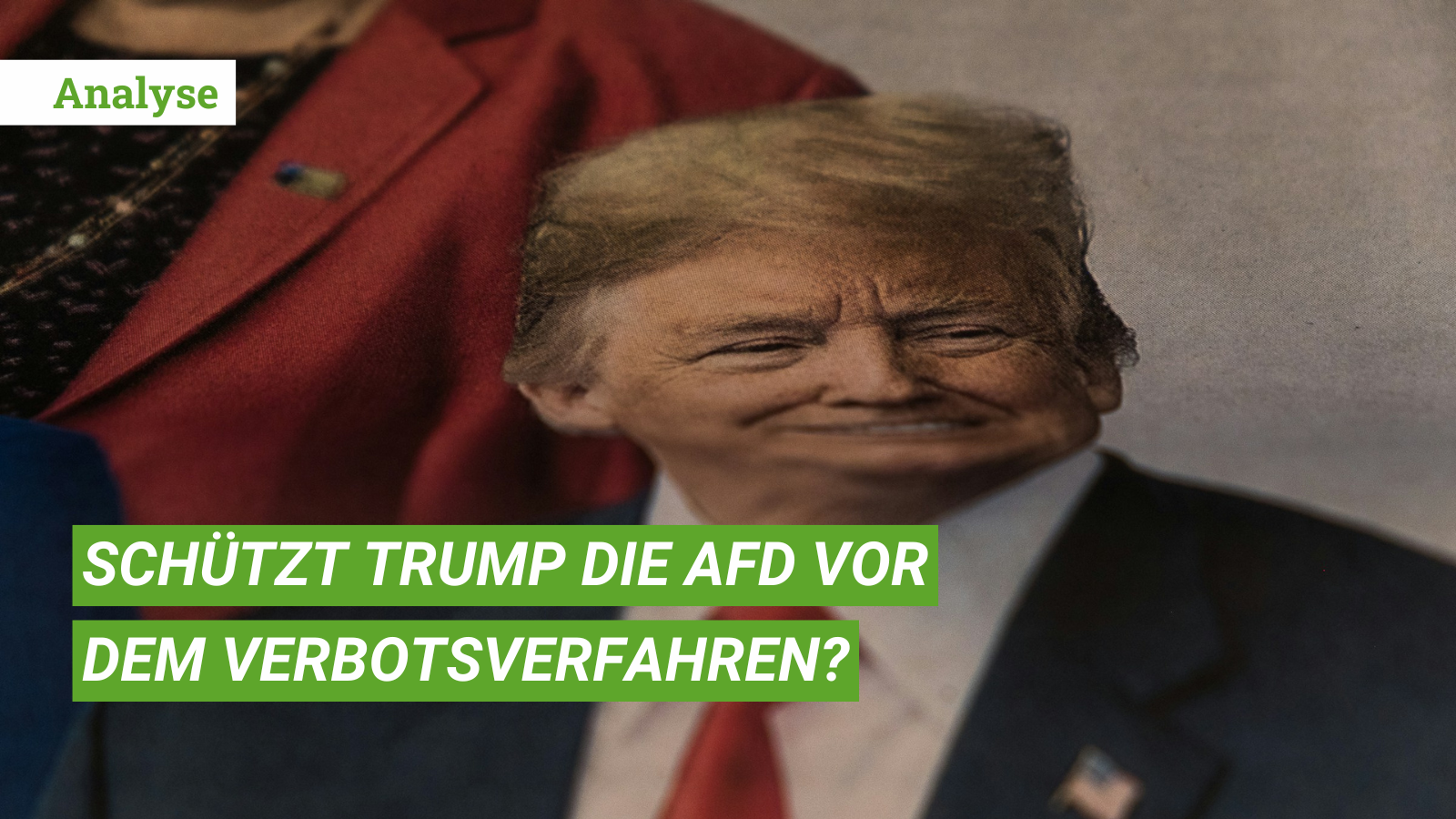Beim Landestreffen des Netzwerks Tolerantes Sachsen kamen fast 100 Aktive der demokratischen Zivilgesellschaft zusammen, um angesichts fortschreitender rechtsextremer Normalisierung Überlebensstrategien zu entwickeln. Im Mittelpunkt stand der Austausch mit Demokrat*innen aus Österreich, Ungarn und der Slowakei.
Von Vera Ohlendorf
Es war bereits das 20. Landestreffen des Netzwerks Tolerantes Sachsen, das – gefördert von der Amadeu Antonio Stiftung – Anfang April über 50 Vertreter*innen von Vereinen und Initiativen ins Kraftwerk in Chemnitz zog. Die Warteliste war lang, denn die sächsische Zivilgesellschaft steht unter Druck: Viele Träger sind akut von Fördermittelkürzungen bedroht und erleben immer häufiger Angriffe auf Veranstaltungen und Büros oder Diffamierungen ihrer Arbeit. Beispiele wie die rechtsextreme Hasskampagne gegen den Verein „Buntes Meißen – Bündnis Zivilcourage“ inklusive Brandanschlag, Bombenattrappe und Fördermittelentzug oder die Anfeindungen der AfD-Stadtratsfraktion gegen den Jugendclub H2 in Glauchau zeigen, dass die Arbeit für Demokratie und Menschenrechte in sächsischen Landkreisen Mut und viel Kraft erfordert. Das Netzwerktreffen war eine wichtige Gelegenheit, um sich über Resilienzstrategien auszutauschen. Im Mittelpunkt stand eine Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen der demokratischen Zivilgesellschaft in Ungarn, Österreich und der Slowakei.
Beschränkungen zivilgesellschaftlicher Arbeit in Ungarn, der Slowakei und Österreich
Veronika Bohrn Mena von der Bundesstiftung COMÚN in Österreich, Bálint Farkas vom ungarischen Netzwerk Civilizacio und Michal Klembara vom Netzwerk Antena aus der Slowakei wissen, was es heißt, wenn autoritäre Regierungen die Arbeit für Demokratie und Minderheitenschutz massiv erschweren oder Grundrechte einschränken.
In Ungarn brachte die seit 2010 amtierende rechtspopulistische Fidesz-Regierung ein Gesetz auf den Weg, das zivilgesellschaftlichen Organisationen den Zugang zu Finanzierung erheblich erschwert. Bálint berichtet, dass staatliche Förderprogramme zwar vorhanden seien, ihre Mittel aber an Organisationen fließen, die der Regierung nahestehen. Diese dulde keine Kritik und übe Zensur aus. Zum Ende der vormals partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Regierung und Zivilgesellschaft habe auch das ungarische „Agentengesetz“ beigetragen. Dieses kriminalisiert zivilgesellschaftliche Akteur*innen, die finanzielle Mittel aus dem Ausland, etwa über Stiftungen oder EU-Förderung, erhalten und führt zu restriktiven Kontrollen durch die ungarischen Finanzämter. Die Androhung weiterer Sanktionen habe den Effekt, dass Träger ihre Arbeit aus Angst einschränkten und es vermieden, sich öffentlich kritisch zu äußern.
Verbindungen zwischen FPÖ und der Terrorgruppe Sächsische Separatisten
Veronika aus Niederösterreich berichtet, dass sich die öffentliche Demokratieförderung der österreichischen Regierung allein auf Sensibilisierung gegenüber Antisemitismus und Gedenkarbeit im Kontext des 2. Weltkrieges beschränke. Entsprechende Programme werden durch den Nationalratspräsidenten gestaltet, dessen Büroleiter Verbindungen zur Terrorgruppe der Sächsischen Separatisten pflegte. Demokratische Strukturen, Landes- und Kommunalparlamente würden zunehmend durch die extreme Rechte dominiert, was zu einer Zunahme rechtsextremer Gewalt auf den Straßen führe. Die Stiftung vergibt spendenfinanzierte Kleinststipendien an kritische Journalist*innen, organisiert Diskussionsveranstaltungen und unterstützt Wissenschaftler*innen und Medienschaffende, die wegen ihrer kritischen Aktivitäten durch die extreme Rechte verklagt werden. „Wir haben Morddrohungen bekommen und sind bei Veranstaltungen auf Personenschutz angewiesen. Die Baseballschlägerjahre sind zurück“, berichtet Veronika.
Die Slowakei hat seit 2023 eine linkspopulistisch-rechtsnationale Regierung unter Premier Robert Fico, die trotz Widerstand der Zivilgesellschaft eine restriktive Kulturpolitik und Zensur betreibt. Michal beschreibt, wie leitendes Personal aus Kulturinstitutionen systematisch gegen regierungsnahe Personen ausgetauscht, der öffentliche Rundfunk umgebaut und Fördermittel gekürzt werden. Glücklicherweise gelinge es immer wieder, geplante Gesetzesänderungen durch Proteste abzuwehren oder Modifizierungen durchzusetzen. Massive Eingriffe in die Kunstfreiheit und politischen Restriktionen seien dennoch spürbar. „Wir organisieren permanent Druck von allen Seiten, aber das ist zeitlich und personell auch schwierig“, beschreibt Michal.
Voneinander lernen und grenzüberschreitend zusammenarbeiten
Die Podiumsgäste betonten die Bedeutung zivilgesellschaftlichen Protestes. Es sei wichtig, auch in Zeiten von Zensur und systematischen Einschränkungen der Arbeit Menschenrechtsverletzungen und Missstände sichtbar zu machen und denen eine Stimme zu geben, die sonst keine haben. Bedeutsam sei die europaweite Vernetzung und Zusammenarbeit, auch um Ressourcen zu teilen und grenzüberschreitende Projekte zu entwickeln. „Es ist nötig, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu verstehen. Wir werden von der Zivilgesellschaft in europäischen Ländern aber oft erst eingeladen, wenn die Katastrophe schon eingetreten ist“, stellt Bálint fest.
Besser sei es, sich frühzeitig auf die Politik autoritärer Regierungen vorzubereiten, internationale Kontakte aufzubauen und resilient zu werden. „Rechtsextreme in Europa sind eng miteinander vernetzt, auch finanziell“, beschreibt Veronika. „Wir brauchen mehr zivilgesellschaftlichen Austausch, um auf diese Entwicklungen reagieren zu können“, sagt sie. Es komme darauf an, Kommunikationsstrategien zu professionalisieren, als Zivilgesellschaft positiv sichtbar zu werden und Fundraising unabhängig von öffentlichen Förderungen zu betreiben.
Aufgeben ist keine Option
Die Inhalte des Podiums wurden durch die Teilnehmenden des Netzwerktreffens im Anschluss intensiv diskutiert. In Workshops hatten sie Gelegenheit, Ideen und Strategien für erfolgreiches Unternehmenssponsoring, Schutzstrategien bei öffentlichen Veranstaltungen, positive Kommunikation über die eigene Arbeit und Demokratieförderung in ländlichen Räumen zu beraten.
Fazit: Die sächsische Zivilgesellschaft hat aus dem Treffen viele Impulse mitgenommen, um sich noch stärker gegen Bedrohungen zu wappnen und gegen die rechtsextremen Verhältnisse aktiv zu werden. Weitere Strategie- und Landestreffen werden folgen, denn: Aufgeben ist keine Option.