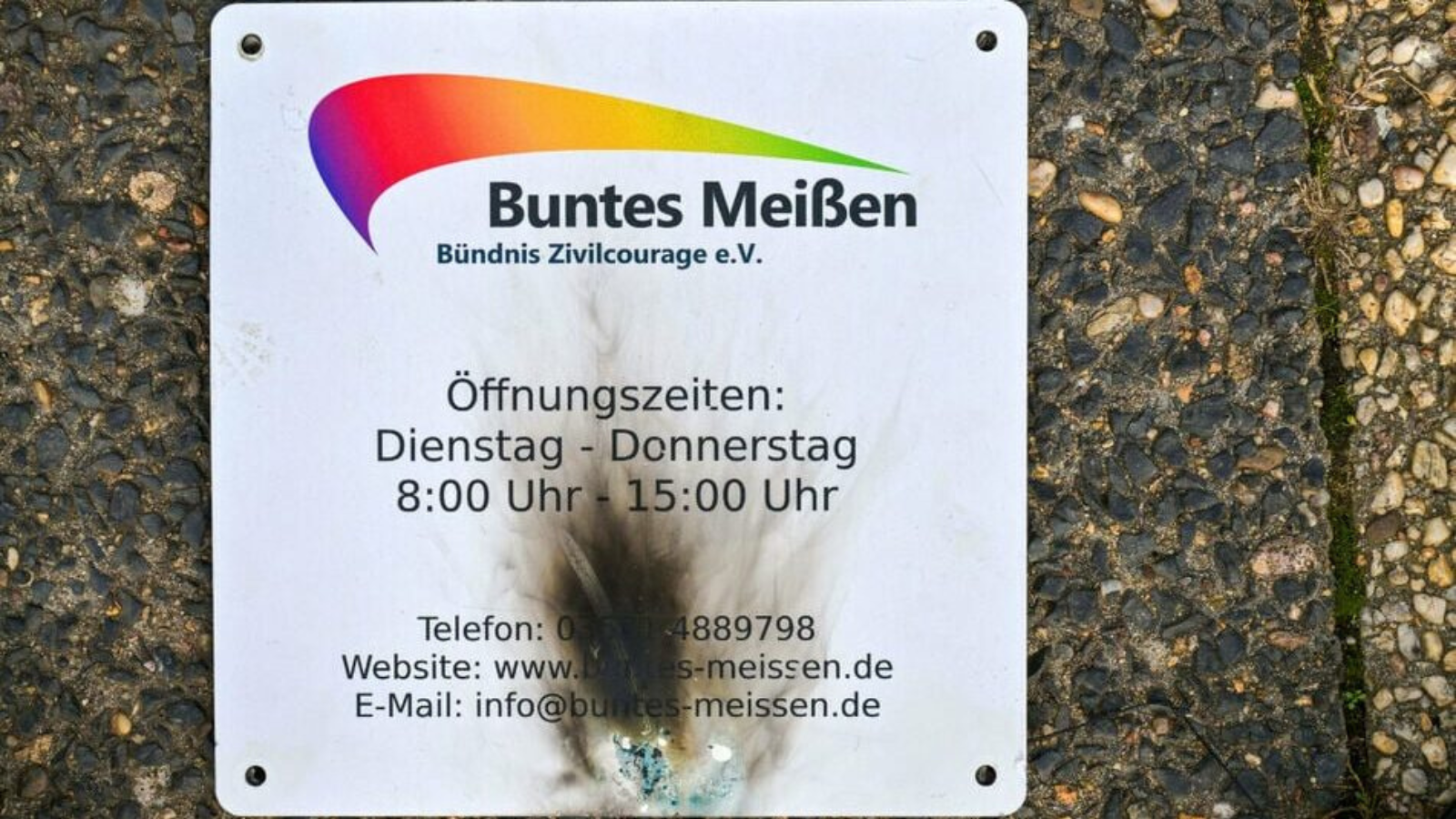Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD bundesweit als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft. Das bedeutet, dass die Behörde nach intensiver Prüfung davon überzeugt ist, dass die Partei als Ganzes aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet – insbesondere durch Missachtung der Menschenwürde, des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips.
„Maßgeblich für unsere Bewertung ist das die AfD prägende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis, das ganze Bevölkerungsgruppen in Deutschland abwertet und in ihrer Menschenwürde verletzt. Dieses Volksverständnis konkretisiert sich in einer insgesamt migranten- und muslimfeindlichen Haltung der Partei“, begründet der Verfassungsschutz die Entscheidung.
Was darf der Verfassungsschutz jetzt machen?
Diese Einstufung ist die höchste Alarmstufe im Verfassungsschutz und erleichtert die nachrichtendienstliche Beobachtung erheblich.
Der Verfassungsschutz kann die Partei und ihre Mitglieder weiterhin observieren, V-Leute anwerben und Telekommunikation überwachen. Es sind die gleichen Mittel wie bisher auch, aber die Verhältnismäßigkeit ist leichter zu begründen. Die Maßnahmen sind rechtlich eher gerechtfertigt und können umfassender angewandt werden.
Die AfD und ihre Finanzierung können intensiver überwacht werden. Außerdem darf die Behörde die Öffentlichkeit umfassender über die verfassungsfeindlichen Bestrebungen der Partei informieren.
Kommt jetzt das Parteiverbot?
Ein Parteiverbot gegen die AfD geschieht nach der Einstufung keineswegs automatisch. Die AfD bleibt weiterhin eine zugelassene Partei, darf an Wahlen teilnehmen und ist im Bundestag vertreten.
Ein Verbotsverfahren ist komplex und langwierig: Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung müssen einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen. Es müssen umfassende Beweise vorgelegt werden, dass die AfD als Ganzes verfassungswidrig ist. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet dann über ein Verbot.
Die jetzige Einstufung ist dafür aber eine wichtige Grundlage. Sie bestätigt, dass die Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiert.
Insbesondere jene Politiker*innen, die sich bisher gegen ein Verbotsverfahren ausgesprochen haben, müssen sich jetzt fragen, ob eine gesichert verfassungsfeindliche Partei wirklich eine „Partei wie jede andere“ ist.
Können AfD-Mitglieder jetzt noch im Staatsdienst tätig sein?
Beamte haben eine besondere Treuepflicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber die AfD-Mitgliedschaft allein führt nicht automatisch zur Entfernung aus dem Staatsdienst. Beamte sind auch nicht verpflichtet, Parteimitgliedschaften offenzulegen.
Behörden müssen weiterhin individuell nachweisen, dass ein*e Lehrer*in oder Polizist*in tatsächlich verfassungsfeindliche Positionen vertritt. Erst ein AfD-Verbot hätte unmittelbare und pauschale Folgen für Mitglieder im Staatsdienst, etwa die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis.
Bayern und Hessen haben bereits angekündigt, AfD-Mitglieder im Staatsdienst genauer zu überprüfen. Es gibt aber noch keine einheitliche Regelung oder sofortige Maßnahmen.
Die rechtlichen Hürden für eine Entfernung aus dem Dienst sind gesunken, aber nicht verschwunden.
Bekommt die rechtsextreme AfD jetzt trotzdem Steuergelder?
Die AfD erhält weiterhin staatliche Parteienfinanzierung. Die Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“ ist nicht automatisch mit einem Ausschluss verbunden.
Über den Ausschluss entscheidet das Bundesverfassungsgericht in einem speziellen Verfahren – was etwas anderes ist als das Parteiverbotsverfahren. Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung können das Verfahren beantragen. Die rechtliche Grundlage dafür wurde 2017 ins Grundgesetz eingefügt (Artikel 21 Absatz 3 GG). Damit wurde Die Heimat (ehemals NPD) für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen, weil sie darauf ausgerichtet ist, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen.
Die AfD könnte von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden, wenn sich eines der drei Verfassungsorgane zu einem entsprechenden Antrag entschließt.
Müssen Lehrer*innen jetzt nicht mehr „politisch neutral“ sein?
Die AfD bringt gern ein Neutralitätsgebot gegen Lehrkräfte und die politische Bildung in Stellung, um sie mundtot zu machen – und legt es dafür falsch aus:
Das Neutralitätsgebot verbietet, im Unterricht einseitig oder provokativ für eine Partei zu werben oder diese zu diffamieren. Aber: Lehrer*innen sind gesetzlich verpflichtet, demokratische Werte wie Menschenrechte und Toleranz zu vermitteln.
Gegenüber einer verfassungsfeindlichen Partei wie der AfD dürfen Lehrkräfte kritisch Stellung beziehen. Die politische Bildung soll pluralistisch bleiben, aber rechtsextreme Positionen sind nicht als legitimer Teil des demokratischen Meinungsspektrums zu behandeln.
Die Einstufung stärkt die Möglichkeit und sogar die Pflicht von Lehrkräften, die AfD als verfassungsfeindlich zu benennen und ihre Inhalte kritisch zu behandeln, ohne dabei das Neutralitätsgebot zu verletzen.