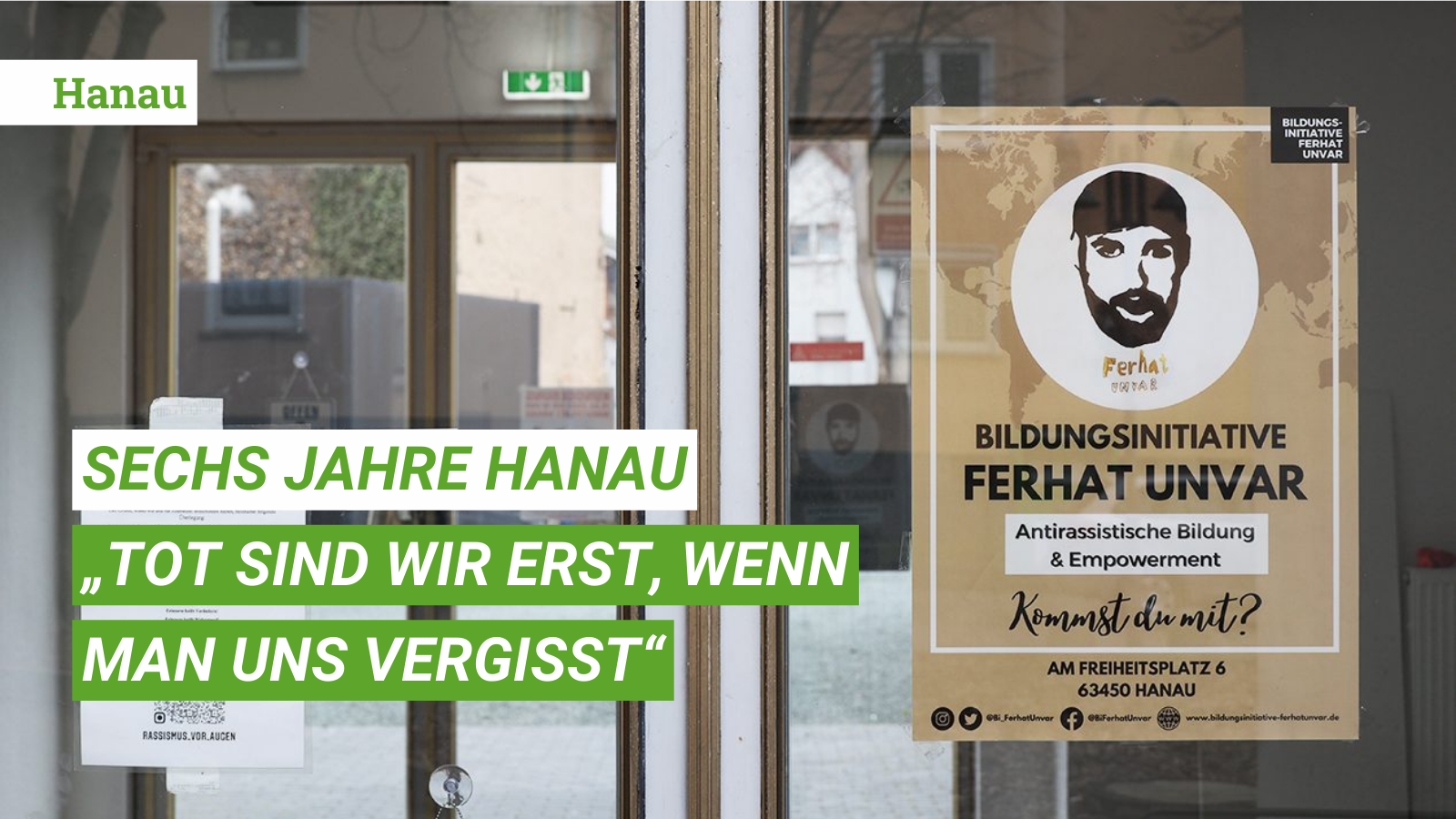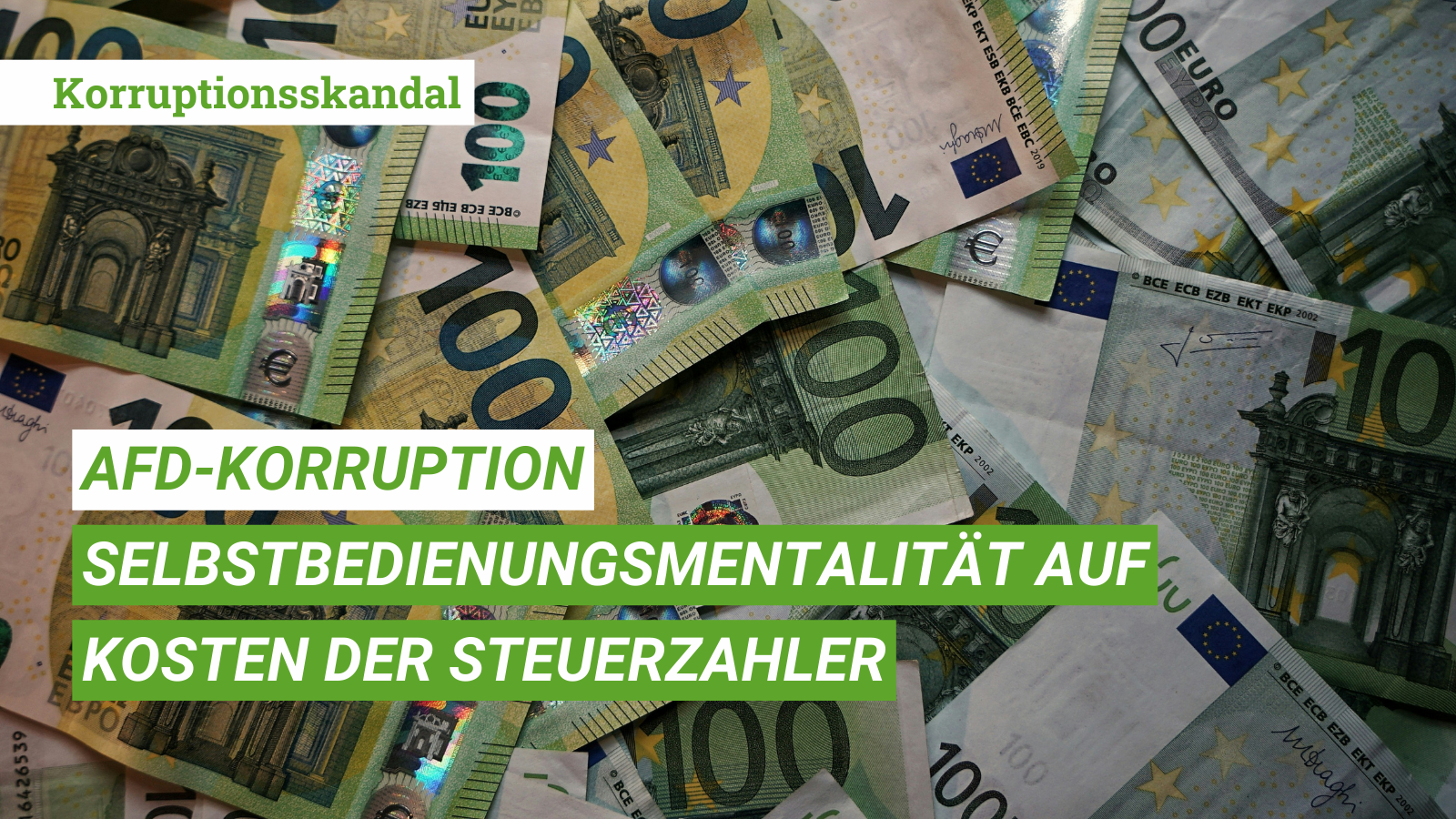Lebenslange Freiheitsstrafe für den Täter von Solingen. Der letzte Prozessbericht.
Von Adalet Solingen
Entgegen der ursprünglichen Ankündigung wurde das Urteil im Prozess gegen Daniel S. nicht wie geplant um 15:30 Uhr verkündet, sondern erst um 16:05 Uhr. Der zunächst genannte Zeitpunkt war offenbar nicht mehr haltbar. Bereits gegen 15:30 Uhr waren jedoch Schöffen auf dem Flur zu sehen, was darauf hindeutet, dass der Vorsitzende Richter die zusätzliche Zeit nutzte, um seine Urteilsbegründung abschließend zu formulieren und seine Notizen zu ordnen.
Um 16:05 Uhr verkündete das Gericht schließlich im Namen des Volkes das Urteil gegen den Angeklagten Daniel S.:
Wegen mehrfachen Mordes in Tateinheit mit mehrfach versuchtem Mord, Brandstiftung, schwerer Brandstiftung sowie mehrfacher Körperverletzung wurde der Angeklagte schuldig gesprochen. Das Gericht verurteilte Daniel S. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zudem stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete die anschließende Sicherungsverwahrung an.
Im Anschluss an die strafrechtliche Entscheidung folgte die zivilrechtliche Festlegung der Entschädigungszahlungen. Das Gericht sprach Schmerzensgeld, sowie Hinterbliebenenleistungen in unterschiedlicher Höhe zu: 20.000 Euro, 2.000 Euro, 15.000 Euro und 10.000 Euro. Die Beträge sind auf Hinterbliebene der Familie Z. sowie die Familie K. aufzuteilen.Im Rahmen der Adhäsionsentscheidung (Schadensersatz und Entschädigung) wurde festgelegt, dass die zugesprochenen Geldbeträge mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen sind. Darüber hinaus haftet der Angeklagte auch für zukünftige materielle und immaterielle Schäden, die infolge der Taten entstanden sind. Diese und weitere sogenannte Adhäsionsansprüche wurden vom Gericht vorläufig festgestellt und können zu einem späteren Zeitpunkt noch erweitert oder konkretisiert werden. Abschließend wurde dem Angeklagten auferlegt, die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Die Prozessberichterstattung stammt von Adalet Solingen und wurde dort zuerst veröffentlicht.
Richter Kötter beginnt die Urteilsbegründung mit dem Hinweis, dass es sich bei der verhängten Strafe um die höchste handelt, die das deutsche Strafgesetzbuch vorsieht. Er macht deutlich, dass auch für ihn persönlich und für die Kammer die Verhängung einer solchen Strafe keineswegs alltäglich sei. Es handele sich nicht um einen normalen Fall, sondern um eine Ausnahmesituation, auch aus Sicht des Gerichts.
Im weiteren Verlauf der Urteilsbegründung kündigt Richter Kötter an, nun stichpunktartig zur Einordnung der psychischen Voraussetzungen des Angeklagten überzugehen, zur besseren Verständlichkeit für alle Anwesenden, wie er sagt. Dabei verweist er auf den psychiatrischen Sachverständigen Prof. Dr. Faustmann, dessen Einschätzungen er mehrfach aufgreift.
Im Mittelpunkt steht zunächst das Aufwachsen des Angeklagten. Nach Auffassung des Gerichts hat der elterliche Haushalt entscheidend dazu beigetragen, dass Daniel S. eine tiefe Entwurzelung erfahren habe. Ausgelöst durch die Trennung der Eltern und den Umzug mit der Mutter nach Mecklenburg-Vorpommern. Dieses frühe Erleben von Instabilität und Ortswechsel habe bei ihm das Gefühl ständiger Bindungslosigkeit hinterlassen.
Daniel S. sei früh ein Einzelgänger gewesen, so der Richter. Die Wertevermittlung im Elternhaus wird als fragwürdig beschrieben. In den Explorationen habe Daniel S. diese Lebensphase selbst als ein Dasein ohne Anschluss beschrieben, ein permanentes Gefühl des Nicht-richtig-Ankommens. Ihm hätten Bezugspersonen gefehlt, auch soziale Kontakte seien nur in geringem Maße vorhanden gewesen oder hätten ganz gefehlt. In der Summe habe sich so, wie es im Gerichtssaal formuliert wird, ein sehr „blasser“ Mensch entwickelt – ein Mensch, dem grundlegende Orientierung, soziale Eingebundenheit und Wertebezug fehlten.
Also jemand, dem es an all diesen sozialen und gesellschaftlichen Bezügen fehlte, der mit diesen Werten nichts verbinden könne. Der Vorsitzende kommentiert die Entwicklung des Angeklagten mit den Worten, „es muss da doch vieles im Argen gelegen haben.“ Anschließend spricht er über den Betäubungsmittelkonsum, der bei Daniel S. schon sehr früh begonnen habe.
Er führt aus, dass Daniel S. nie in einen sozialen Kontext eingebunden gewesen sei, wie es bei einer solchen Form des Konsums sonst üblich sei. Auch bei der Beschaffung und dem Konsum der Drogen habe er nicht auf gemeinsamen Konsum innerhalb Peer-Groups oder ein gemeinsames Partyleben zurückgegriffen, sondern in stiller Einfalt allein konsumiert. Er bezeichnet ihn wortwörtlich als „Eigenbrötler“ und „Einsiedler“ und spricht resümierend von einer „unguten Mischung“.
Bezüglich des Drogenkonsums führt der Richter aus, dass Daniel S. sich an einzelnen Stellen Hilfe gesucht habe und somit selbst erkannt haben muss, wie hoch sein Konsum gewesen sei. Zudem habe Daniel S. in einer Exploration angegeben, es fühle sich an, als habe er „zwei Betriebssysteme“ in sich. Der Sachverständige verneinte jedoch eine Schizophrenie, die seine Freundin, die Zeugin Jessica B., erwähnt hatte und die Daniel S. ihr gegenüber angeblich angesprochen habe.
Der Amphetaminkonsum von Herrn S. sei also so ausgeprägt gewesen, dass er sich eigenständig zu einer Therapie entschied. Allerdings habe Daniel S. sich nicht motivieren können, diese Therapie länger durchzuhalten. Er verbrachte viel Zeit passiv auf der Couch und zeigte keine intrinsische Motivation sich, beispielsweise beruflich, zu betätigen. Die Ausbildung brach er ab und die meiste Zeit blieb er ohne Beschäftigung.
Zusätzlich kamen weitere Stressfaktoren hinzu. Richter Kötter erwähnt in diesem Zusammenhang die Partnerschaften des Angeklagten, die brüchig gewesen seien und nicht die stabilisierende Wirkung entfaltet hätten, die in der ersten Exploration noch angenommen wurde. Auch die Ex-Freundin Luisa Maria P. habe die Persönlichkeit des Angeklagten als von geringer Motivation und innerer Schwäche geprägt geschildert. Jessica B. hingegen habe eine auf den ersten Blick stabilisierende Situation dargestellt, die jedoch lediglich eine äußere Fassade gewesen sei, hinter der es innerlich ganz anders ausgesehen habe, so hatte es Dr. Faustmann ausgeführt. Die Nebenklage habe diese Verbindung zu Jessica B. einseitig interpretiert. Richter Kötter äußerte, man könne nun überlegen, welche Worte zur Beschreibung der Situation geeignet seien. Er griff das von Nebenklageanwältin Seda Başay-Yıldız benannte „Doppelleben“ des Täters auf.
Demnach habe sich Daniel S. seinen Problemen entzogen, sich isoliert und nicht geöffnet, was auch durch die Aussagen der Zeugin Jessica B. bestätigt wurde. Der soziale Rückzug habe bereits im Jahr 2014 begonnen. Ab diesem Zeitpunkt sei der Angeklagte teilweise tagelang abwesend gewesen. Auch die Daten aus der Google-Cloud belegten seine Aktivität während dieser Zeit. In Phasen des Rückzugs habe Daniel S. seinen Umgang mit der Situation vor allem durch elektronische Musik gefunden.
Weiterhin beschrieb Kötter den Angeklagten als unauffälligen Zeitgenossen mit situativ adäquatem Verhalten gegenüber Mitmenschen und hilfsbereiter Haltung. Er habe kurze soziale Kontakte absolvieren können und war in der Lage, mit Nachbarn zu sprechen und ihnen bei Bedarf Hilfe zu leisten. Eine dauerhafte und verlässliche Bindung sei ihm jedoch nicht gelungen.
Er habe, so betont Kötter, eine „sehr vernünftige Bildung“. Und spricht dann davon, dass Daniel S. „keineswegs dumm“ sei. Der Richter führte weiter aus, dass den Bekanntenkreis von Daniel S. überwiegend unauffällige Kontakte prägten. Er betonte mehrfach, dass diese Kontakte, auch in Bezug auf die sogenannte „Landsmannschaft“, unauffällig gewesen seien.
Der Begriff „Landsmannschaft“ wurde von ihm wiederholt verwendet. Ob dies ein möglicher juristischer Begriff für Staatsangehörigkeit oder eine Umschreibung für Menschen mit einer Migrationsgeschichte ist, blieb unklar. Auffällig war jedoch, wie häufig er diesen Begriff in seinen Ausführungen nutzte, wohingegen er sich auch im Verfahren erwehrt hatte, Worte wie „Rassismus“ klar zu benennen.
Bezogen auf die Aussagen der Zeug*innen im Verfahren stellte Kötter fest, dass diese keinen gewalttätigen Psychopathen beschrieben hätten, sondern vielmehr einen Menschen, der angenehm auftrat, liebenswert wirkte und sich in belastenden Situationen zurückgezogen habe.
Weiter führte er aus, dass sich der Angeklagte an manchen Tagen offensichtlich nicht wohl gefühlt habe. Im Jahr 2022 habe sich aufgrund seiner brüchigen Persönlichkeit und als Selbstschutz das Bild eines instabilen Menschen weiter verdichtet. Kötter verwies darauf, dass man dies auch an Verhaltensweisen erkenne, wie sie etwa bei Personen zu beobachten seien, die sich selbst verletzen durch „ritzen“ – jedoch mit dramatischen Auswirkungen auf die Opfer. Mit dieser Art des Gleichsetzens von Selbstverletzungen und mehrfachem Mord bagatellisierte er das Verhalten von Daniel S. in Anwesenheit der Betroffenen seiner Taten und der Angehörigen der Opfer, die ihm im Rahmen der Urteilsverkündung gegenüber saßen.
Zu Beginn der Urteilsbegründung widmete Richter Kötter also viel Zeit der oben dokumentierten Darstellung von Daniel S. als einem Menschen, der bereits früh im sozialen Umfeld benachteiligt gewesen sei und nur wenige soziale Kontakte sowie keinen wirklichen Halt gehabt habe. Anschließend verglich er die aufkommende Aggression des Angeklagten mit Verhaltensweisen, die als autoaggressiv einzustufen seien.
Das Publikum empfand die Ausführungen merklich als sehr unangenehm. Deutlich war eine sich langsam ausbreitende Unruhe zu spüren, die sich in vermehrtem Raunen äußerte. Die Wut darüber, wie der Richter seine Worte wählte und sich ausdrückte, war im Saal spürbar.
Nachdem Richter Kötter diesen letzten Vergleich angestellt hatte, erklärte er, dass Daniel S. in Stresssituationen versuche, die Kontrolle über sich und sein Verhalten durch verursachten Schaden zurückzugewinnen, der ihm in diesen Momenten eine Art Abhilfe verschaffe. Die Unruhen, das Nichtschlafen und das ständige Umherlaufen wertete er als Kompensationsmechanismen, körperliche Reaktionen auf das, was Daniel S. empfinde.
Kötter stellte heraus, dass vor dieser Phase keine auffälligen Verhaltensweisen bekannt gewesen seien, sondern erst später destruktives und schwerwiegendes Verhalten bei ihm aufgetreten sei. Diese Einschätzung werde durch den psychiatrischen Gutachter Prof. Dr. Faustmann bestätigt, der ausgeführt habe, dass Daniel S. vor allem ein Ventil gesucht habe, um Selbstwirksamkeit zu erlangen. Dabei hätten vor allem die Orte, denen er Schaden zufüge, im Fokus gestanden, nicht primär die Menschen selbst.
Vor dem ersten Brandereignis 2022 in der Grünewalderstraße lägen keine Hinweise vor, die auf vergleichbare Vorfälle oder eine entsprechende Tendenz schließen ließen. Dies wird insbesondere dazu genutzt, um die im Vorfeld geäußerten Vorverurteilungen bezüglich rassistischer Motive zurückzuweisen.
Bis zu den Brandlegungen zeigten sich Anzeichen einer fortschreitenden Eskalation, vor allem in Bezug auf die psychische Verfassung von Daniel S. Hierbei wurde Herr Prof. Dr. Faustmann dafür gelobt, dass er das Bild von Daniel S. unter Einbeziehung dessen Vorgeschichte nachvollziehbar skizziert hat. Die Darstellung der Vorbereitungen zu den Brandlegungen wird als entlastend bewertet. Auch negative Gefühle und der Konflikt mit der Vermieterin werden als belastende Faktoren genannt, ohne dass deren genaue Bedeutung für die Tat analysiert wird.
Der Richter beschreibt den von ihm so genannten „Kipppunkt“ im Jahr 2022, als Daniel S. erstmals in der Grünewalderstraße mit Grillanzündern und weiteren präparierten Mitteln einen Brandversuch unternahm. Dabei wird dargestellt, dass ab diesem Zeitpunkt eine deutliche Eskalation eingetreten sei. Das psychiatrische Gutachten von Dr. Faustmann wurde vom Gericht erneut als nachvollziehbare Grundlage herangezogen, welches aufzeigt, dass Daniel S. gezielt an einen ihm bekannten Ort zurückkehrte, den er mit negativen Erlebnissen verbindet, um dort die Brandstiftung zu begehen. Richter Kötter sagt, deshalb habe sich der Ort besonders dazu geeignet, den bei ihm bestehenden Überlegenheitswahn auszuleben. Die Verknüpfung mit der eigenen Biografie sei laut Kötter von zentraler Bedeutung gewesen.
Im weiteren Verlauf spricht Kötter von möglichen Stressoren, die eine Rolle gespielt haben könnten. Gleichzeitig relativiert er den Begriff und bezeichnet ihn selbst als möglicherweise euphemistisch und unangebracht. Wörtlich sagt er „Stress hört sich immer so wenig an.“ Er beschreibt die Situation als eine, in der der innere Druck habe nach außen dringen müssen, als eine Art unausweichliche Reaktion.
Bezüglich der während der Verhandlung aufgeführten möglichen Motive, spricht Kötter sowohl rassistische als auch stressbedingte mögliche Ursachen an. Er bezeichnet beides als gleichermaßen „unfassbar“. Im Originalwortlaut: „Das eine oder das andere ist so oder so unfassbar.“ Er fügt hinzu „Das kann man ja gar nicht beschreiben.“
Er geht anschließend darauf ein, dass Daniel S. grundsätzlich in der Lage gewesen sei, sein Handeln zu erkennen und die Konsequenzen einzuschätzen. Es sei ihm, so ein Zitat von Prof. Dr. Faustmann, „gar nicht um die anderen oder die vermeintlichen Opfer gegangen“, sondern „es gehe ihm um sich selbst.“ In diesem Zusammenhang zieht Kötter einen Vergleich zur Stressbewältigung anderer Menschen und sagt, dass andere „Holzhacken gehen“ würden, eine direkte Gegenüberstellung zum Verhalten von Daniel S.
Zum Ende verweist er darauf, dass einige der Brände sich nicht so entwickelt hätten, wie es der Angeklagte geplant hatte. Im Originalzitat: „Es hat nicht so funktioniert, so wie er sich das vorgestellt hat.“
Richter Kötter verweist darauf, dass der Brandsachverständige keine Milderungsgründe gesehen habe. Zwar habe dieser nochmals auf bestimmte Aspekte hingewiesen, jedoch betont, dass Daniel S. zu keinem Zeitpunkt Anzeichen eines Rücktritts vom Tatgeschehen oder vergleichbare Handlungen gezeigt habe, die auf ein Innehalten oder Umdenken hätten schließen lassen. Zudem habe der Angeklagte die Gefährdung der Bewohner erkennen und einschätzen können.
Kötter geht in diesem Zusammenhang auf die psychischen Folgen ein, die die Taten bei vielen Betroffenen hinterlassen hätten. Diese seien, unabhängig von der konkreten Tat, weiterhin deutlich spürbar. Die Rede ist von Mord, versuchtem Mord und besonders schwerer Brandstiftung, Delikte, die der Richter als „unfassbar“ bezeichnet. Besonders hebt er die Todesangst hervor, die in dem Notruf hörbar gewesen sei, und stellt die Frage „Was müssen die da durchgemacht haben?“ Gemeint sind dabei insbesondere die Bewohner*innen des Dachgeschosses, Familie Z. sowie die Familie K., die aus großer Höhe aus dem 3. Stock des brennenden Gebäudes gesprungen sei. Kötter spricht in diesem Zusammenhang von „heroischen Dingen“.
Er hebt das Verhalten von Herrn Ö. hervor, der beim ersten Brand in der Grünewalder Straße überlegt gehandelt habe und zunächst einen gehbehinderten Mann aus dem Haus geführt habe.
Anschließend nimmt der Richter Bezug auf die Ausführungen der Nebenklageanwältin Seda Başay-Yıldız. Er zeigt sich kritisch gegenüber ihrer hinterfragenden Haltung zur Feuerwehr und betont, dass im Jahr 2024 die Einsatzkräfte sehr schnell reagiert hätten und dass die Brandsätze, die sich 2022 unter der Kellertreppe befanden, nicht gezündet hätten und bezeichnet den Brand 2022 in dem Zusammenhang als „dilletantisch“. Im Gegensatz zu dem Brandanschlag 2024: Da brannte es „lichterloh“. Anschließend geht er auf Details der verschiedenen Brände ein. In der Josefstraße hätten Nachbarn zum Beispiel die Tür offen stehen lassen und dass 2024 Daniel S. deutlich mehr Brandbeschleuniger benutzt hätte, mit Docht und Zündschnur. Im Vorfeld hatte er Details hierzu gegoogelt, wie „Benzinkanister“ und „Explosion“.
Den Brand in der Josefsstraße nennt er einen Nebenschauplatz. Es habe Auseinandersetzungen mit einem anderen Bewohner des Hauses gegeben, in deren Zusammenhang Daniel S. dessen Bankkarte gestohlen und rund 30.000 Euro unterschlagen habe.
Er sagt aber, dass das nur Nebenaktivitäten seien und gar nicht der Hauptfokus, um den sich hier zu kümmern sei. Er zählt hier abermals etwas auf, was mit dem Urteil scheinbar gar nichts zu tun hat und auch im Verfahren nicht zur Debatte stand und kommentiert dies auch so. Den eventuellen Lasten der jeweilig Betroffenen nimmt Kötter sich auch in diesem Zusammenhang nicht an.
Der Richter spricht über die Netzaktivitäten von Daniel S., in denen sich Hinweise auf Stressfaktoren vor dem 15. Februar finden. Themen seien kriminelle Aktivitäten, mit denen er sich intensiv beschäftigt habe, erkennbar an seinen Suchanfragen. Dass der erste Brand in der Josefstraße keine mediale Beachtung fand, habe er als Niederlage empfunden. Die „Katastrophe“ 2024 in der Grünewalder Straße werde er nun im Folgenden näher beschreiben.
Der Richter führt aus, dass Daniel S. um 2:29 Uhr erstmals auf dem Kamerabild erscheint und sich in Richtung des Brandobjekts bewegt. Drei Minuten später sei zu sehen, wie er sich eine Zigarette anzündet und nochmals zurückgeht. Sieben Minuten danach kehrt er erneut zum Brandort zurück und entfernt sich dann wieder. Laut Aufnahmen sowie der Aussage der Zeugin Breuer war er bereits zwei Stunden zuvor vor Ort. Kötter beschreibt, dass Daniel S. bereits früher am Abend bzw. in der Nacht dort „umherstrich“. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits Brandsätze bei sich trug oder später weitere gelegt habe, sei unklar.
Um 2:40 Uhr verlässt der Täter laut Videoaufzeichnung den Tatort. Um 2:47 Uhr geht der erste Notruf ein, um 2:53 Uhr werden die Stadtwerke alarmiert, und um 2:55 Uhr trifft die Drehleiter als letzte Einheit am Einsatzort ein.
Der Richter betont, dass Kritik an möglichen Fehlern legitim sei, äußert jedoch deutlich, dass die öffentliche Infragestellung der Feuerwehr durch Nebenklageanwältin Seda Başay-Yıldız in diesem Fall nicht gerechtfertigt sei. Wörtlich sagt er, wenn sich Frau Başay-Yıldız „dahin stellt und die Feuerwehr in Frage stellt“, sei das unangemessen. Er verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Aussage eines Feuerwehrhauptwachtmeisters, der geschildert habe: „Dann sprangen die, dann war für uns keine Veranlassung, die Drehleiter weiter auszufahren.“
Kötter hebt hervor, dass Başay-Yıldız als Opfervertreterin zwar parteiisch sein dürfe, jedoch sei es in diesem Moment unangemessen gewesen, zu diskutieren, warum die Feuerwehr nicht früher ausgerückt sei. Er sagt: „Auch wenn ich da jetzt einen Shitstorm kriege, das würde ich beanstanden.“ Der Richter verweist erneut auf die Aussage des Feuerwehrhauptmanns, der diesen Einsatz als den schlimmsten seiner 25 Dienstjahre bezeichnete. Bei jemandem, „von dem man zu Recht erwartet, dass er einiges gesehen hat“. Das Erlebte habe die Einsatzkräfte stark mitgenommen, etwa der Flammenschlag aus den Fenstern und das Bild, das sich ihnen beim Eintreffen bot, „als schon praktisch nichts mehr zu machen war“.
Er geht nochmals auf die Kritik von Basay-Yildiz ein und lobt im Gegensatz dazu Herrn Bona für seinen Umgang mit dieser. Bona habe die Kritik „einfach weggesteckt“, obwohl sie ihn hätte treffen können. Dabei bezieht er sich darauf, dass Başay-Yıldız Bezug auf den Kommentar von Staatsanwalt Bona genommen hat „durch verschlossene Türen hätte womöglich Schlimmeres verhindert werden können.“ Die Türöffnung habe es „natürlich schwerer gemacht, die Familien noch retten zu können“. Hier kritisierte Başay-Yıldız im Vorfeld stark die Verschiebung der Verantwortung und darin enthaltene Täter-Opfer-Umkehr. Dazu sagt Kötter in Bezug auf die Aussage von Staatsanwalt Bona: „Das war natürlich überhaupt gar kein Vorwurf, das kann ich auch verstehen, dass man das analysiert.“ Er fügt hinzu, auch er selbst sei „nicht ganz richtig zitiert worden“ und habe das „nicht ganz fair“ gefunden. Auch ihm hätten die Maßregelungen durch Başay-Yıldız zugesetzt. Dies habe keine besonnene Verhandlungsatmosphäre gefördert, vielmehr sei es zu „demonstrationsartigen Verhältnissen“ im Sitzungssaal gekommen.
Er lobt die Anwesenden, insbesondere die Opfer und Angehörigen, für ihre Selbstbeherrschung im Kontrast zur Gefühllosigkeit des Täters: „Bewundernswert, wie Sie das hier schaffen.“ Er spricht auch nochmal – und hier zitiert er den Verteidiger – von der hohen Verantwortung, die auch unter dem Eindruck vom Brandanschlag in Solingen 1993 im Gerichtssaal zu spüren gewesen wäre.
Kritik weist Kötter dort zurück, wo etwa Başay-Yıldız den Staatsanwalt als „menschenverachtend“ bezeichnet habe. Solche Äußerungen gingen seiner Ansicht nach „weit über das Ziel hinaus“. An die Familie Zhilov gerichtet sagt er: „Wir (die Kammer) haben uns das nicht leicht gemacht.“
Er geht nochmals auf den Zeugen ein, der zu Protokoll gegeben hatte, er habe „gesehen, wie da einer gebrannt hat“. Kötter betont, dies sei laut Ortsbegehung und Aussagen des Brandsachverständigen so nicht möglich gewesen. Die Aussagen des Zeugen seien zudem uneinheitlich gewesen. Seit der Rekonstruktion müsse klar sein, dass dieser lediglich Feuer gesehen habe.
In erschütternder Detailliertheit beschreibt Kötter, wie die Familie Zhilov zu Tode gekommen sein muss. Er geht auf den Anruf um 2:45 Uhr ein: „Bruder, Bruder, wir verbrennen hier“ und erklärt, dass die Todesursache eine Rauchgasvergiftung gewesen sei, die dem Verbrennen der Körper zeitlich vorausging. Es sei eine große Menge giftiger Rauch eingeatmet worden. Dies hätten auch die rechtsmedizinischen Untersuchungen der Leichen ergeben. Weitere Verletzungen seien nicht todesursächlich gewesen. Er stellt fest, dass alle Opfer von Daniel S. psychisch für ihr Leben gezeichnet seien. Die psychische Dimension sei kaum vorstellbar. Mit Blick auf den Geschädigten Herr K. sagt Kötter, dessen Zustand habe sich zwar inzwischen zum Glück gebessert, aber zwischenzeitlich „hörte sich das ja gar nicht so vielversprechend an“. Was Familie K. und andere durchleiden müssten, sei kaum in Worte zu fassen.
Dann wendet sich Kötter an René S., der im Sitzungssaal anwesend ist. Er erinnert daran, dass René S. und der Täter früher befreundet gewesen seien. In diesem Moment schauen sich die beiden an. Zur Tat an René S. sagt er, es müsse bei Daniel S. eine emotionale Aufladung gegeben haben, als dieser unvermittelt auf ihn einschlug, ihn mit einem Spray und anschließend mit einer Machete attackierte. Dies seien gezielte Verschleierungsbemühungen gewesen. Eine Bagatellisierung auch dieser Tat von Daniel S.
An René S. gewandt sagt Kötter, dieser sehe heute schon erstaunlich viel besser aus, wenn man dessen Schädelfrakturen und Verletzungen noch vor Augen habe und sagt, das war ja ein Wunder, der Schädelknochen war abgesprungen und teilweise skalpiert. Das sei, Zitat: „schon hinterhältig, wenn einen der beste Freund hinterhältig angreift“.
Kötter hält kurz inne und reflektiert: „Vielleicht sollte ich es anders machen und bei den Dingen bleiben, die das Urteil herbeiführen.“ So korrigiert auch er sich im Sprechen, sagt aber dennoch die Dinge, die er nicht sagen will.
Er führt aus, dass die Tat aus dem Jahr 2024 zwar für sich genommen monströs gewesen sei, die vorhergehenden Taten aber schon für ein lebenslanges Strafmaß ausgereicht hätten: Für die Tat 2022 – 9 Jahre, für die Josefstraße – 6 Jahre, für die Tat gegen René S. – nochmals 9 Jahre. Zusammengenommen hätte dies ohnehin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe geführt. Mit der Tat in der Grünewalder Straße sei die Schwelle für lebenslänglich, insbesondere mit besonderer Schwere der Schuld in der Vielzahl von Getöteten und Geschädigten, weit überschritten. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung würde ja auch klar darauf hindeuten, dass Daniel S. „für sehr lange Zeit nicht mehr frei“ kommen werde.
Er fragt rhetorisch: „Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt noch weiter in Details versteigen soll.“ Es ginge hier schließlich um lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld und Sicherheitsverwahrung. Kötter geht nochmals auf das Geständnis von Daniel S. ein und darauf, dass dieser sich schließlich doch einer psychologischen Exploration unterzogen habe, obwohl er dies zunächst abgelehnt hatte. Ob das den Opfern helfe, bleibe fraglich. Prof. Dr. Faustmann habe in drei Gesprächen jedoch Erkenntnisse über Daniel S. gewonnen, denen er sich freiwillig gestellt habe.
Kötter beschreibt Daniel S. als apathisch und regungslos, jetzt, während der gesamten Verhandlungstage und während der Urteilsverkündung. Dennoch bezeichnet er es als besondere Leistung, dass Daniel S. sich eingelassen und ausgesagt habe. Denn das Anrecht auf Wahrheit der Opfer würde dem Schweigerecht, das ein Angeklagter in diesem Moment habe, widersprechen. Die Geschädigten könnten letztlich froh sein, dass Daniel S. sich zu diesem Schritt entschlossen habe. Nun gebe es ein Gesicht: „Sie wissen jetzt: Das ist der, der dafür verantwortlich ist.“
Dann spricht er die Frage an, ob es sich bei Daniel S. um einen rechtsradikal motivierten Täter handelt. Dabei stellt er klar, Seda Başay-Yıldız habe mit ihren Forderungen nach weiteren Ermittlungen richtig gehandelt. Sie habe berechtigt auf die Interessen der Opfer verwiesen und auch ihre Interviews in der Presse seien „überhaupt gar kein Problem“. Problematisch sei allerdings der von ihr erhobene Vorwurf der Vertuschung.
Kötter argumentiert: Im Gegenteil, der Rechtsstaat habe hier funktioniert. Die Polizei habe Fehler gemacht, die Staatsanwaltschaft habe diese nicht verschleiert, die Nebenklage habe sie benannt, die Kammer habe sie aufgenommen. Dann sei die Notwendigkeit entstanden, diese Ermittlungen nachzuholen. Dass zunächst mit zu wenig Personal gearbeitet wurde, sei ein gesonderter Punkt. Er sagt wörtlich: „Dann war der Skandal geboren.“ Und weiter: „Alles, was da war, ist ausgewertet worden. Die Polizei hat sozusagen gebüßt.“ Er betont: „Wir haben uns immer bemüht, sodass wir uns jetzt auch nicht so fühlen müssen, dass wir nicht alles getan hätten.“
Er verweist auf § 202 StPO (Beweiserhebung) und sagt, alle erforderlichen Maßnahmen seien ergriffen worden. Der Aufwand sei enorm gewesen und der Umfang, der darin noch zu „tuenden Maßnahmen“ unterschätzt worden. In bestimmten Bereichen sei „herausragend ermittelt“ worden. Teils hätten Beamt*innen über 100 Stunden gearbeitet, auch an Wochenenden.
Kötter wendet sich gegen die Interpretation von Başay-Yıldız und betont, dass ein rechtsradikales Motiv klar nachgewiesen werden müsse, um es als solches zu benennen. Die Konflikte mit ausländischen Nachbarn, etwa mit Herrn H. aus der Normannenstraße, seien laut Prozessverlauf eher Nachbarschaftsstreitigkeiten gewesen. Başay-Yıldız habe in ihrem Plädoyer davon gesprochen, dass sie selbst in ihrer geschützten Welt lebten, wo so etwas nicht passiere. Er sagt dazu: Auch Daniel S. habe in einem Haus mit hoher Diversität der Anwohnerschaft gelebt.
Er wirft der Nebenklage vor, an einigen Stellen nicht ganz korrekt zitiert zu haben. Es habe lediglich eine Suchanfrage bei Compact gegeben, keine tiefergehenden Recherchen. Zur Löschung der rechtsradikalen Inhalte auf einer Festplatte sagt er, diese habe bereits vor der Sicherung stattgefunden, es gebe keine Anzeichen, dass der Täter versucht habe, die Daten vorher wiederherzustellen. Daraus etwas abzuleiten, sei „sehr weit gegriffen“.
Er geht nochmals auf den Vergleich ein mit Hanau, der ursprünglich von Başay-Yıldız angeführt wurde. Auch dort habe man dem Täter zunächst keine rechtsextremen Aktivitäten nachweisen können, „dann hat man ihn auf links gedreht, und dann hat man gesehen, wes Geistes Kind der ist, wie er sich radikalisiert habe“. Bei Daniel S. sei das ausdrücklich nicht der Fall gewesen.
Zum Brand in der Normannenstraße sagt er, dass nach menschlichem Ermessen kein anderer Täter in Frage komme. Daniel S. habe hierzu allerdings nichts gesagt. Kötter rät ihm: „Nutzen Sie Ihre Zeit sinnvoll.“ Er reflektiert nochmals die Exploration durch Prof. Dr. Faustmann und wirft die Frage auf, ob die Idee, dass dort Menschen sterben für die eigene Selbstaufwertung, notwendig gewesen sei. Darüber könne man jetzt nur spekulieren.
Zum Adhäsionsverfahren (Schadensersatz und Entschädigung) sagt er, dieses habe vor allem symbolischen Wert: „Wenn man da jetzt noch ein bisschen Geld kriegt.“ Abschließend wendet er sich erneut an Daniel S.: Man werde ihn in der JVA jetzt „genau unter die Lupe nehmen, auch was die Psyche betrifft“. Er ginge davon aus, dass Herr Bona dies bereits veranlasst habe.
Zum Schluss spricht Kötter sich für einen fairen Umgang im Gericht aus, auch wenn man nicht immer einer Meinung sei. Den Opfern und Angehörigen wünscht er: „Alles Gute, sofern das möglich ist.“
Damit endet seine Urteilsbegründung und die gesamte Verhandlung.
Der Artikel erschien ursprünglich bei Belltower.News.