… und die Gefahren, die vom Rechtsextremismus heute ausgehen. Sie sind Teilnehmer eines Schulprojekts, das vom Verein „Zukunft gestalten – ohne zu vergessen“ ins Leben gerufen wurde. Gefördert durch die stern-Aktion „Mut gegen rechte Gewalt“ der Amadeu Antonio Stiftung.
Es gibt Lehrer, die ihren Schülern das Thema Nationalsozialismus spannend vermitteln können. Dass es nicht genügt, das Schulbuch von vorne bis hinten durchzuarbeiten und Jahreszahlen auswendig lernen zu lassen, gilt erst recht für das furchtbarste Kapitel der deutschen Geschichte. Welche verheerenden Folgen beispielsweise die Vernichtung der Juden für Deutschland und Europa hatte, können Zahlen allein nicht verdeutlichen. Doch selbst wenn es dem Lehrer gelingt, die Klasse für das Thema zu interessieren, indem er ergänzend zum Unterricht beispielsweise mit ihnen eine Gedenkstätte besucht – vielen Jugendlichen fehlt etwas Entscheidendes: der Bezug zur Heimatregion. Was ist in dieser furchtbaren Zeit eigentlich bei uns im Ort passiert? Was ist mit den Jüdinnen und Juden geschehen, die hier früher gelebt haben? Wo ist der alte jüdische Friedhof geblieben? All diese Fragen brennen auch Schülerinnen und Schülern aus dem sächsischen Weißwasser auf den Nägeln. Mit ihren historischen Recherchen beteiligen sich jetzt Elftklässler an einem neuen Projekt des Vereins „Zukunft gestalten – ohne zu vergessen“, das durch die stern-Aktion „Mut gegen rechte Gewalt“ der Amadeu Antonio Stiftung gefördert wurde. Schülerinnen und Schüler begeben sich auf Spurensuche und erforschen die NS-Zeit und Ursachen neuer Formen von Rechtsextremismus in Weißwasser und Umgebung.
„Wir helfen den Jugendlichen bei der Themensuche“, erzählt die Vereinsvorsitzende Gudrun Albrecht: „Manche befassen sich mit jüdischer Geschichte vor Ort, andere interessieren sich mehr für die aktuellen Probleme“. Denn Rassismus und Rechtsextremismus sind vielerorts inzwischen eine ernste Gefahr für die demokratische Stabilität geworden – da macht auch Weißwasser in der Oberlausitz keine Ausnahme. Es macht durchaus Sinn, die Ereignisse zur Zeit des Nationalsozialismus mit der rechtsradikalen Szene heute zu vergleichen – nicht eins zu eins, versteht sich, doch Parallelen sollen gezogen werden, damit die Jugendlichen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht getrennt voneinander betrachten kann. Dieser Ansatz findet sich auch im Vereinsnamen wieder: Zukunft kann demnach nur gestaltet werden, wenn man die Vergangenheit nicht aus den Augen verliert, sondern kritisch bewertet. Und dazu gehören eben nicht nur die positiven Seiten einer Stadt, auf die die Bürger stolz sein können, wie in Weißwasser z.B. die traditionelle Glasindustrie, sondern auch die Zeit des Nationalsozialismus.
Wo befand sich der jüdische Friedhof?
Der Verein „Zukunft gestalten – ohne zu vergessen“ bringt eine Schriftenreihe heraus, die sich mit den Spuren jüdischen Lebens in Weißwasser und den antijüdischen Pogromen der Nationalsozialisten in Weißwasser und dem benachbarten Bad Muskau beschäftigt. Ein Thema, über das bis dato Stillschweigen bewahrt wurde, sowohl während 40 Jahre DDR als auch in den Jahren nach der Wende. Dass wichtige Aspekte der Lokalgeschichte einfach ausgeblendet werden – damit wollen sich sowohl der 83-jährige Hobbyhistoriker Werner Schubert als auch die 18-jährige Susann Schmiedgen nicht abfinden. Die Gymnasiastin forschte in einer Belegarbeit nach den Spuren des ehemaligen jüdischen Friedhofs in Weißwasser – und wurde fündig. 1982 wurde das Gelände an der Mühlenstraße eingeebnet, und mit ihm ein Stück jüdische Ortsgeschichte. Das Areal wurde anschließend in einen Park umgestaltet. Das Gegenteil von Geschichtsaufarbeitung also, um die sich die DDR in den meisten Fällen erfolgreich gedrückt hat. Darum kümmern sich jetzt engagierte Menschen wie Werner Schubert und Susann Schmiedgen, die gemeinsam für eine generationenübergreifende historische Spurensuche stehen und damit schon altersmäßig eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft darstellen. Werner Schubert hat in einer 72 Seiten umfassenden Forschungsarbeit Kurzbiografien aller jüdischen Bürger von 1881 bis 1945 recherchiert, die in Weißwasser geboren wurden oder gelebt haben.
Das Ziel des Geschichtsprojektes ist es, aktuelle und ältere Forschungsarbeiten – zumeist von Jugendlichen – zu sammeln, um ausgehend von dieser Recherche mit den Bürgern der Stadt in einen Dialog zu treten. Für Herbst 2008 sind Diskussionen und Veranstaltungen geplant, die sich neben historischen Themen beispielsweise auch dem Abbau von Vorurteilen gegenüber Minderheiten und dem Engagement gegen Rechtsextremismus widmen.
Jan Schwab
Foto: Martina Hanold, Lausitzer Rundschau

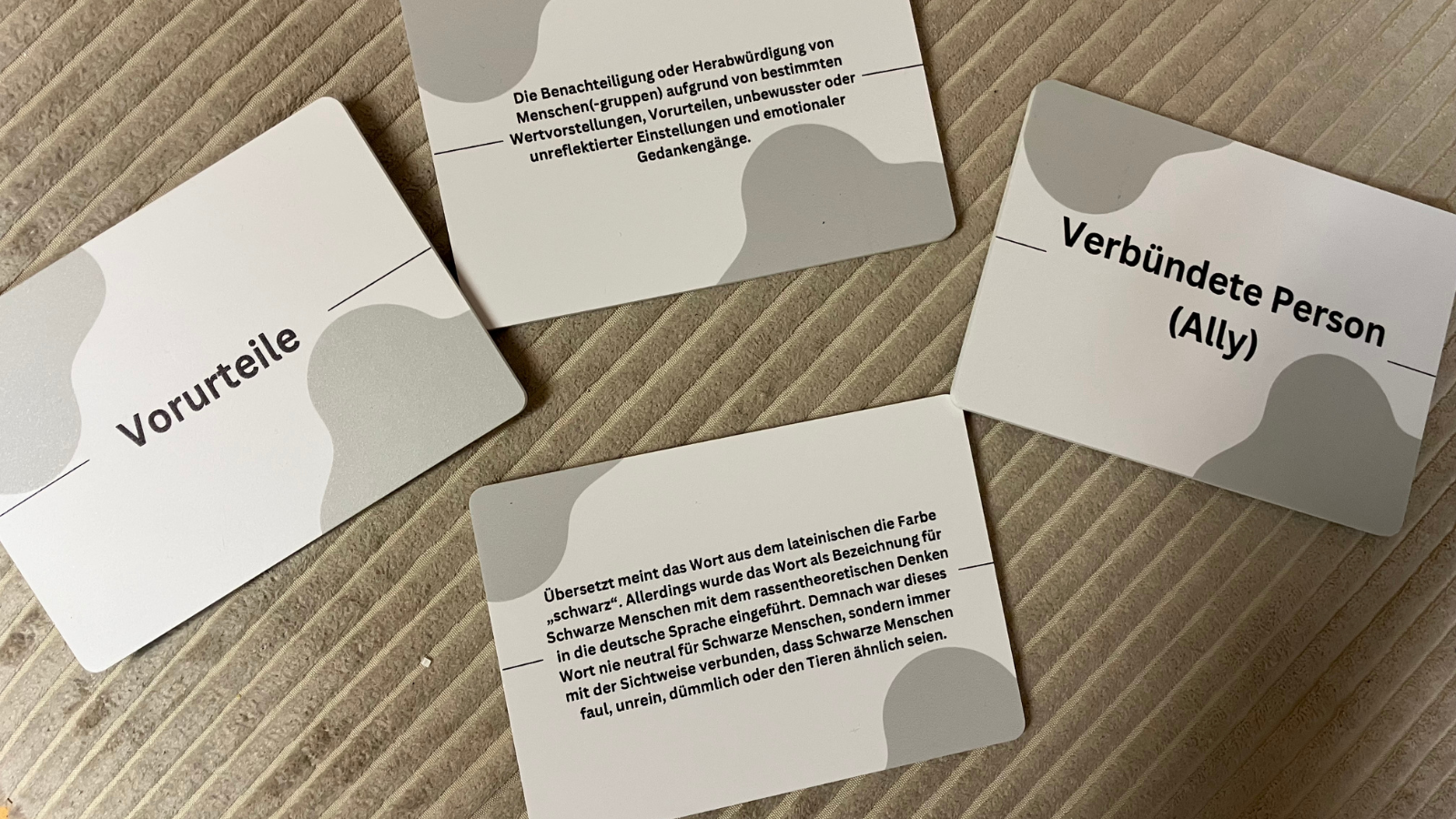
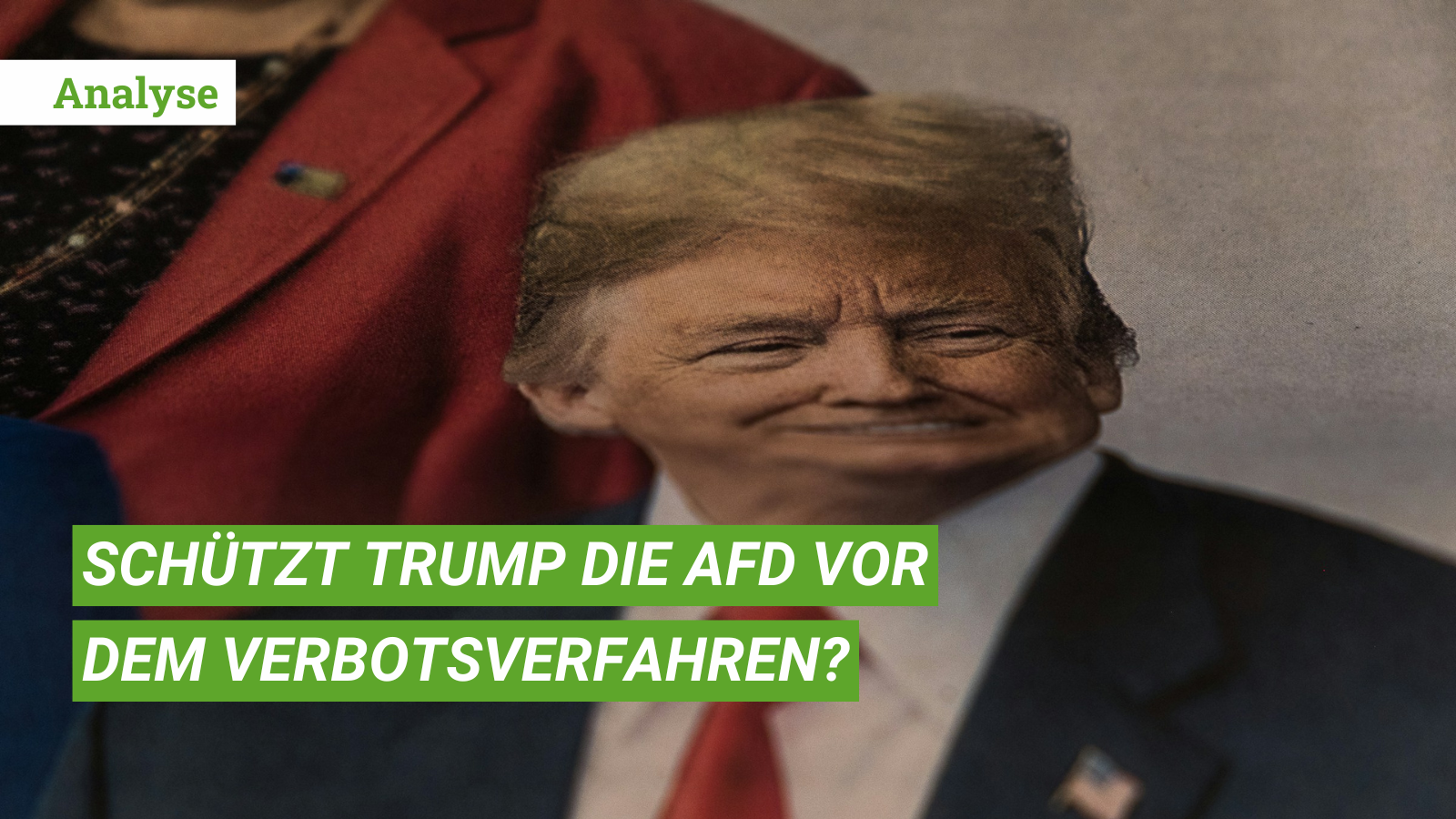
![Aktionswochen_[transfer]_Header_ohne Logos klein](https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2023/11/transfer_Header_ohne-Logos-klein.png)