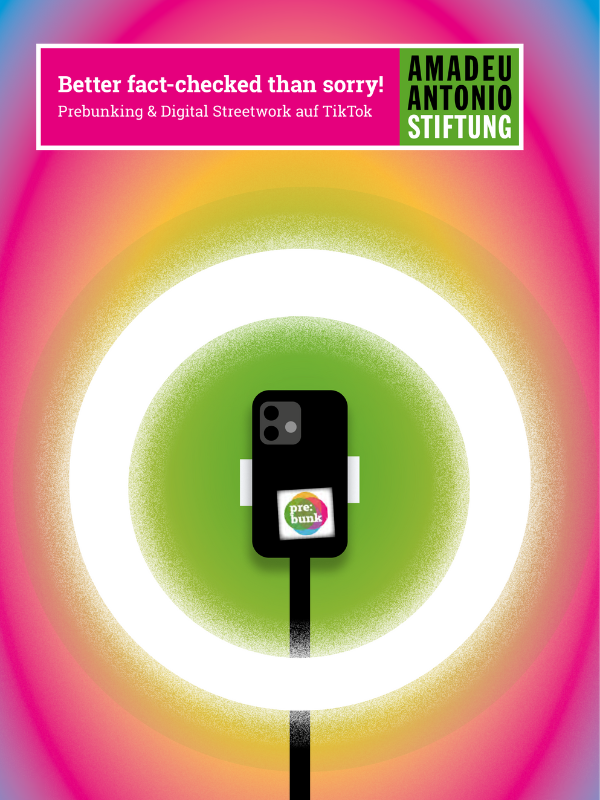ABC der digitalen Zivilgesellschaft

Was bedeutet das eigentlich, digitale Zivilgesellschaft? Unser ABC ist ein Glossar für zentrale Begriffe. Jeder Buchstabe erklärt aktuelle sowie zeitlose Internetphänomene und digitale Herausforderungen. Gleichzeitig ist das ABC ein praktischer Leitfaden für Social-Media- und Community-Manager*innen. Jeder Begriff liefert praktische Einblicke und Tipps, um Engagement und Resilienz der digitalen Zivilgesellschaft zu verstehen und zu stärken.


A wie Anonymität
Wissen
Anonymität im Internet – ein Thema um das seit Jahren gestritten wird. Gerade wenn es um Hassrede oder digitale Gewalt geht, wird oft eine Klarnamenpflicht gefordert. User*innen wären dann verpflichtet, nur noch ihren Klarnamen für Social Media Profile zu verwenden. Dahinter steckt der Wunsch, strafrechtliche Verfolgung zu erleichtern. Gleichzeitig ist bis heute die Vorstellung weit verbreitet, Anonymität verleite dazu, online andere enthemmt(er) zu beleidigen und anzugreifen. Das stimmt allerdings nicht. Ein Großteil strafbarer und nicht-strafbarer Hasskommentare wird ohnehin unter Klarnamen veröffentlicht. Und: Klarnamen schützen nicht vor Angriffen, wenn es unter den User*innen gar kein Unrechtsbewusstsein gibt.
Auch für eine strafrechtliche Verfolgung ist eine Klarnamenpflicht nicht notwendig. Verfasser*innen von rechtswidrigen Kommentaren können anhand ihrer IP-Adressen identifiziert werden. Eine Klarnamenpflicht bedeutet stattdessen ein Risiko für diejenigen, die auf Anonymität im Internet angewiesen sind. Dazu zählen zum Beispiel Betroffene rassistischer und antisemitischer Gewalt, Journalist*innen oder nicht-geoutete LGBTIQs im ländlichen Raum. Sinnvoller wäre es, wenn die Politik sich konsequent an die Seite Betroffener stellt, soziale Netzwerke bei Menschenfeindlichkeit stärker durchgreifen und User*innen sich gegenseitig unterstützen.

B wie Berlin
Wissen
Berlin hat auf der Straße eine starke Zivilgesellschaft. Und auch im Netz kämpfen Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen für Menschenwürde und Demokratie. Wir haben einige von ihnen gefragt, weshalb Zivilgesellschaft im Netz so wichtig ist







Praktische Tipps
Zivilgesellschaftliche Meldestellen erfassen und dokumentieren diskriminierende Vorfälle. Hier können nicht nur verbale Übergriffe und Gewalttaten sondern auch digitale Vorfälle gemeldet werden. In Berlin gibt es beispielsweise folgende Anlaufstellen:
- Rechtsextreme und diskriminierende Vorfällen mit Berlin-Bezug: Register Berlin, Reach Out Berlin
- Antifeminismus: Meldestelle Antifeminismus
- Antisemitismus: Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin
- Rassismus: Each One Teach One, Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin
- Rassismus gegen Rom*nja und Sinti*zze: Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA), DOSTA – Dokumentationsstelle Antiziganismus
- Antikurdischer Rassismus: Informationsstelle Antikurdischer Rassismus
- Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität: LesMigraS, L-Support, MANEO, StandUp, Meldestelle Antifeminismus

C wie Community-Management
Wissen
Community-Manager*innen moderieren Kommentare auf ihren Social-Media-Seiten und regen Diskussionen an. Sie sorgen für ein Gesprächsklima, in dem niemand Angst haben muss, bedroht oder beleidigt zu werden. Community-Management stärkt und begleitet demokratische Debatten. Man könnte auch sagen: Community-Management ist die Care-Arbeit des Internets. Wie andere Care-Arbeit auch ist die Arbeit meistens unsichtbar und wird oft schlecht, manchmal sogar gar nicht bezahlt. Mit unzureichenden Ressourcen ausgestattet, kennt sie keine Wochenenden oder Feiertage, sondern muss rund um die Uhr erledigt werden. Solange sie gewährleistet ist, wird sie als Selbstverständlichkeit hingenommen. Wer verstehen will, welche Bedeutung Moderation für die sozialen Netzwerke hat, der stelle sich kurz vor, es würde sie nicht geben. Je nach Perspektive wären die meisten Social-Media-Seiten dann ein Ort zum Fürchten – oder noch mehr, als sie das sowieso schon sind. Weiterlesen: Care-Arbeit für die Kommentarspalten. Was Community-Manager*innen für Online-Debatten tun und aushalten
Praktische Tipps
Haltung zeigen

- Menschenfeindlichkeit klar entgegentreten
- Hate Speech melden und löschen/verbergen
- Kommentare mit strafrechtlicher Relevanz zur Anzeige bringen

- Diskriminierende Kommentare oder Angriffe auf Nutzer*innen ignorieren
Debunking

- Links zu verschwörungsideologischen Websites oder Videos löschen
- Mit Faktenwissen dagegen argumentieren
- Nach- und Gegenfragen stellen und Gegenbeispiele liefern

- Falschinformationen und Verschwörungsideologien unwidersprochen lassen
Diskussionskultur

- Sachlichen und konstruktiven Meinungsaustausch stärken, z.B. durch Fragen oder Zusatzinformationen
- Fokus auf positive Kommentare und Austausch statt nur auf Hate Speech

- Diskussionen ignorieren oder unterbinden
Kritik

- Kritische Kommentare und Nachricht ernst nehmen und sachlich reagieren
- Anregungen reflektieren und in die eigenen Inhalte aufnehmen

- Konstruktive Kritik ignorieren oder löschen
Selbstfürsorge

- Psychische Belastung durch Hate Speech ernstnehmen
- Bewusst Ausgleich und Entlastung schaffen
- Bei anhaltender Belastung professionelle Unterstützung suchen

- Körperliche und psychische Bedürfnisse ignorieren


D wie Dark Social
Wissen
Der Begriff Dark Social bezeichnet private oder nur in Teilen öffentliche Kommunikation. Dazu zählen Plattformen wie Discord, E-Mails oder Messenger wie WhatsApp oder Telegram. Rechtsextreme nutzen Dark Social beispielsweise um ihre Anhänger über Channel unabhängig von großen Plattformen und Algorithmen zu mobilisieren. Auch Gruppenchats werden zur Vernetzung und Verbreitung von (Des-)Informationen genutzt. Mehr dazu: Kommentar zu Dark Social
Zum Reinhören:

Podcast #11 Dark Social
In der 11. Folge des de:hate-Podcasts befassen wir uns mit Rechtsextremen und Verschwörungsideolog*innen auf Telegram – besonders seit Beginn der Corona-Pandemie haben diese enormen Zulauf.
Praktische Tipps
Zunehmend werden eigentlich unpolitische Chatgruppen genutzt, um diskriminierende, rechtsextreme oder verschwörungsideologische Inhalte zu verbreiten. Was also tun, wenn die Grenzen verschwimmen und im Gruppenchat auf einmal Links zu verschwörungsideologischen Websites oder Falschinformationen geteilt werden?

Gegenrede
Checkt Links und Fakten gegen und klärt darüber auf, wenn es sich um Verschwörungsideologien oder unzuverlässige Quellen handelt. Wenn auf einmal rechtsextreme Memes oder Beleidigungen gepostet werden, schreitet ein und bezieht Stellung.

Thematisieren
Bleibt das Problem bestehen, thematisiert es im größeren Kontext in der Gruppe. Kennen sich die Mitglieder, können auch Absprachen getroffen werden, der*die Absender*in direkt angesprochen oder blockiert werden.

Melden
Sowohl bei Telegram als auch WhatsApp können Nachrichten und Gruppen gemeldet werden. Vor allem bei Telegram gab es bisher allerdings kaum Reaktionen bei Meldungen von strafbaren Inhalten – obwohl das Netzwerk sie eigentlich löschen müsste. WhatsApp erhält bei einer Meldung die letzten fünf Nchrichten, die die gemedeldete Person versendet hat. Handelt es sich um Nachrichten, die gegen die Nutzungsbedingungen von WhatsApp verstoßen (z.B. Beleidigungen, Hass, Rassismus, Verherrlichung von Gewalt und Flaschinformationen) wird der*die Nutzer*in gesperrt.
Disclaimer
Bei explizit verschwörungsideologischen oder rechtsextremen Channels gibt es Administrator*innen, die Gegenrede sofort löschen und Kommentierende sperren. Dort einzuschreiten ist praktisch unmöglich. Hier werden besonders offen Gewaltaufrufe und Volksverhetzung verbreitet.

E wie Empowerment-Moderation
Wissen
Wie können wir konstruktiven Dialog und demokratische Argumente in den sozialen Medien stärken? Mit der Studie „Hallo liebe Community!“ zeigen Marc Ziegele und Dominique Heinbach auf, wie mit Empowerment-Moderation konstruktive Debatten sowie eine respektvolle Community unterstützt werden können.
Ziele
Statt nur Regulation von Hate Speech:
- Vermittlung von Kompetenzen zum selbstbestimmten und respektvollen Kommentieren
- Fokusverschiebung auf konstruktive Kommentare
- Motivation für konstruktive Teilnahme stärken
- Selbstregulierung durch gestärkte Community
Rolle der Moderation
- Strukturgeber*in: Orientierung bieten, Fragen stellen, Zusatzinformationen liefern, Ziele der Diskussion benennen
- Vorbild: Anerkennung, positive Diskursbeispiele betonen, respektvoller Ton
- Offenes Ohr: Präsenz, Interaktion auf Augenhöhe, Anregungen und Kritik ernstnehmen
Praktische Tipps
Die Empowerment-Moderation schlägt drei Arten von Moderationsstil vor, die je nach gewählten Ton oder Situation genutzt werden können.
Kognitiver Stil
Ziel: Inhaltlichen Mehrwert der Diskussion fördern
Mittel:
- Durch Eröffnungskommentar zusätzliche Informationen, Argumente und Perspektiven präsentieren
- Expertise der Community durch Nachfragen einholen, z.B. „Wo könnte man hier mit Lösungen ansetzen?“
Affektiver Stil
Ziel: Empathie fördern und Gefühl anerkennen
Mittel:
- Ermutigende Kommentare, z.B. „Das war bestimmt nicht einfach für Sie.“
- Nachfragen
Sozial-integrativer Stil
Ziel: Community-Gedanken fördern und Austausch der Nutzer*innen stimulieren
Mittel:
- Gespräche anregen
- Nutzer*innen miteinander verbinden
- Gemeinsame Erfahrungen und Werte betonen, z.B. „Das geht hier offenbar vielen so.“

F wie Faktencheck
Wissen
Oft ist es nicht leicht, Desinformation auf den ersten Blick zu erkennen. Vor allem wenn sie von Journalist*innen aufgegriffen werden oder reichweitenstark in den Sozialen Medien auftauchen. Um Desinformationen nicht versehentlich zu verbreiten, ist es wichtig doppelt zu prüfen und zu verifizieren. Stellt euch folgende Fragen
- Aus welcher Quelle stammt die Information?
- Ist mir die Quelle bekannt? Gilt sie als seriös oder tendenziös?
- Berichtet mehr als eine seriöse Quelle darüber?
- Werden Behauptungen belegt?
Quellen und Informationen zu überprüfen, kann sehr zeitaufwendig sein. Mittlerweile recherchieren zahlreiche Medien und Initiativen viel verbreitete Gerüchte oder widerlegen Falschinformationen. Dazu zählen Mimikama, Correctiv, #FaktenFuchs und ARD-Faktenfinder.
Zum Reinlesen:

Praktische Tipps
Fake News im Familienchat oder am Küchentisch? Wenn ihr in eurem Bekanntenkreis oder auf Social Media widersprechen wollt, sollten Faktenchecks und Widerlegungen…
- …sich auf gesicherte Informationen statt die Falschinformationen konzentrieren.
- …eine eindeutige Warnung enthalten, dass die Information falsch ist.
- …eine alternative Erklärung beinhalten, die die Falschinformation aufgreift.
Hilfreich ist hier die Methode von John Cook und Stephand Leqandowsky. Konzentriert euch darauf, Gerüchte nicht einfach zu wiederholgen, sondern schmiert ein „Truth Sandwich“:

Wenn absichtlich falsche Informationen über eure Organisation verbreitet werden, kann es sinnvoll sein, dies öffentlich zu kritisieren. Achtet aber darauf, dass ihr falsche und rechtsextreme Narrative nicht stärkt. Jeden Klick werten Algorithmen der sozialen Netzwerke und Suchmaschinen als Hinweis auf Relevanz.

G wie Gerichtsurteile
Wissen
Die Waffe der digitalen Zivilgesellschaft heißt politische Bildung. Bei Menschen mit geschlossenen menschenfeindlichen Weltbildern greift Aufklärung allerdings nicht. Strafbare Hasspostings sollten Konsequenzen haben. Sonst besteht die Gefahr, dass ihre Verfasser*innen und Mitlesende den Eindruck gewinnen, dass solche Aussagen zulässig sind.
Strafanzeigen können Täter*innen organisatorisch und strukturell einschränken, denn sie nehmen den Raum für die öffentliche Artikulation von Hass. Wer glaubt, sein Tun und Reden sei öffentlich toleriert, wird Ausweitungen des Handlungsraums vornehmen und schließlich auch vor Gewalttaten nicht zurückschrecken. So kannst du mit strafrechtlich relevanten Inhalten umgehen.
Urteile

Urteil vom 09.12.2021
Update vom 05.12.2023: X (ehemals Twitter) will die Verantwortung nicht übernehmen und hat gegen das Urteil Berufung eingelegt (Quelle: HateAid).



Urteil ist seit Oktober 2021 rechtskräftig.


H wie Hashtags
Wissen
Eine demokratische Zivilgesellschaft im Netz sollte nicht nur auf rechtsextreme Online-Strategien reagieren. Stattdessen können wir soziale Netzwerke nutzen um unsere eigenen Erzählungen über Demokratie und Menschenrechte zu stärken. Ein Mittel, das sich dafür eignet: Hashtags! Hashtag-Kampagnen wie #metoo oder #BlackLivesMatter bringen Betroffene zusammen, zeigen Haltung und weisen auf Themen oder Missstände hin.
Achtung Hashtag-Hijacking!
Trolle oder politische Gegner*innen kapern immer wieder Hashtags, um rechtsextreme Inhalten zu Aufmerksamkeit zu verhelfen. Um das zu verhindern, ist es sinnvoll, bereits im gewählten Hashtag eine klare Haltung zu vermitteln, die eine Übernahme für Trolle oder Rechtsextreme unattraktiv macht.
Digitale Aktivist*innen können auch selbst über Hashtags rechtsalternative Verständigung stören und rassistischen Aussagen die Reichweite stehlen. Dabei ist allerdings Vorsicht angesagt. Denn so macht man rechtsextreme Akteur*innen auch auf das eigene Profil aufmerksam. Und: rechtsextreme Slogans transportieren oft auch eine rassistische Haltung, die so reproduziert wird.
Praktische Tipps
Ihr wollt eine eigene Hashtag-Kampagne starten?
- Nutzt Aktions- und Gedenktage als Anlass.
- Überlegt vorher: Ist der entsprechende Hashtag bereits von Unternehmen oder anderen Organisationen genutzt worden? Ist er vielleicht zu beliebig? Welche Haltung wollt ihr transportieren?
- Besonders gut funktionieren Hashtags dann, wenn sie den Austausch von Erfahrungen zwischen Unbekannten anregen: Deckt euer Hashtag Themen ab, die viele Nutzer*innen beschäftigen?
- Ein guter Hashtag alleine reicht oft nicht aus. Um breitere Aufmerksamkeit zu erzeugen, aktiviert vor Kampagnen-Start eure Netzwerke und geht auf reichweitenstarke Nutzer*innen oder Organisationen zu, die ähnliche Themen behandeln.
Eine eigene Hashtag-Kampagne ist euch zu umfangreich?
- Diskutiert unter einem bereits bekannten Hashtag mit: Unterstützt, kritisiert, führt Beispiele und Quellen an.
- Um passende Hashtags zu finden, schaut bei anderen Accounts. Nutzt für Aktionen auf der Straße Orts- und Datumsangaben: #Berlin2105 ist besser als #Antischwurbel.
- Nutzt aktuelle Trends, um auf eure Arbeit und Expertise aufmerksam zu machen.

I wie Influencer*innen
Interview mit Raúl Krauthausen und Britta Kiwit
Wer versteht sich eigentlich als Influencer*in? Und spielen Influencer*innen eine Rolle für die digitale Zivilgesellschaft? Wir haben Raúl Krauthausen und Britta Kiwit gefragt!
Raúl Krauthausen ist Inklusions-Aktivist und Gründer der Sozialhelden. Er arbeitet seit über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt. Britta Kiwit betreibt den Tik Tok-Kanal und Instagram-Account avalino.diversity und stellt dort Bücher für mehr Vielfalt vor und thematisiert gesellschaftskritische Fragen.

Würdest du dich als Influencer*in bezeichnen?
Raúl: Ich würde mich selbst nicht unbedingt als Influencer definieren. Ich glaube, Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit passt eher zu mir. Der Begriff Influencer*in steht sehr mit den sozialen Medien in Verbindung und dreht sich stark um die Akquirierung von Likes und Followern.
Britta: Mir fällt die Selbstbezeichnung momentan noch schwer, aber ich merke immer mehr, dass es mir egal ist, ob mich jemand ‚Content Creatorin‘, ‚Sinnfluencerin‘ oder ‚Influencerin‘ nennt – denn die Vorurteile über die gesamte Branche bleiben die gleichen. Ich bleib da flexibel und füge momentan für mich persönlich noch den Halbsatz ‚und mache gesellschaftskritische Comedy‘ hinzu.
Welche Rolle spielen Influencer*innen für die digitale Zivilgesellschaft?
Raúl: Ich sehe Influencer*innen eigentlich eher bedeutend für die Marktwirtschaft und das Konsumverhalten als per se für gesellschaftliche oder politische Themen. Menschen, die auch Soziale Medien nutzen, um auf zivilgesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen, würde ich eher als Aktivist*innen bezeichnen. Die potenzielle Reichweite der Sozialen Medien ist hier natürlich ein Vorteil, doch ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass sich Beiträge oft nur in der eigenen Bubble verbreiten und nur wenige Menschen außerhalb des eigenen Dunstkreises erreichen.
Britta: Ich denke Influencer*innen werden eine immer größere Rolle spielen. Sie sind wie persönliche Werbetafeln für Brands – das ist Gold wert, weil die Glaubhaftigkeit direkt mitgeliefert wird, zumindest in dem Umfeld, in dem ich aktiv bin. Ich lehne momentan 90% aller Kooperationsanfragen ab und arbeite nur mit Brands zusammen, hinter denen ich 100% stehe. Gefährlich wird es dann, wenn Influencer*innen unmoralisch handeln, den Bezug zum Geld verlieren und nur noch aus monetärem Anreiz ‚influencen‘. Das macht meiner Meinung nach den gesamten Sektor kaputt und führt zu einem sehr schlechten Ruf des Berufszweigs, daher bin ich dankbar für strengere Regeln wie ‚Werbekennzeichnungspflicht‘ etc.

J wie Jugendliche
Wissen

Quelle: JIM-Studie 2022
Junge Menschen bewegen sich selbstverständlicher im Internet und begegnen verschiedenen Formen digitaler Gewalt. In einem Klassenchat oder auf Instagram kann genauso wie auf dem Schulhof Diskriminierung und (digitale) Gewalt stattfinden.
Wie also umgehen mit Hass im Netz in der Jugendarbeit? Wenn Jugendliche lernen, aktiv und konstruktiv im Internet für Demokratie, Respekt und Zivilcourage einzutreten, stärkt das die digitale Zivilgesellschaft von morgen.

Quelle: forsa-Befragung 2022
Praktische Tipps
Über Mediennutzung sprechen
- Nicht nur bei problematischen Vorfällen ansprechbar sein: Was sind z.B. Lieblings-Influencer*innen, Apps oder Plattformen?
- Quellen und Medien hinterfragen: Was unterscheidet eine seriöse von einer tendenziösen Quelle? Gibt es die Informationen aus verschiedenen Quellen?
- Bewusstsein wecken: Nicht alles lässt sich prüfen, gleichzeitig sollten wir aber auch nicht unkritisch allem trauen, was im Internet steht
Befähigen statt Verbieten
- Problematische Postings: Wie war der Post gemeint? → Verständnisfragen decken Missverständnisse auf und geben die Möglichkeit, Postings selbst zu prüfen und reflektieren
- Statt erhobenem Zeigefinger: rechtliche Grundlagen sowie rechtsextreme Inhalte, Diskriminierung und Hassrede im digitalen Raum erklären
Regeln
- Vorschläge zum Umgang sammeln: Welche Lösungsvorschläge haben Jugendliche für erlebte Probleme?
- Diskriminierung und menschenverachtende Äußerungen sollten als solche benannt werden: Was ist an einer Aussage rassistisch, islamfeindlich, antisemitisch?
- Strafrechtlich relevante Aussagen und Gegenrede: Anonymes Melden und argumentieren üben
Diskriminierung und Strategien entlarven
- Demokratiefeindliche Gruppen nutzen soziale Medien strategisch um Ideologien zu verbreiten und Jugendliche anzusprechen: Instagram-Filter-Ästhetik, Popkultur, Umweltschutz…
- Im Umfeld der Jugendliche über aktive Gruppen und Anspracheformen informieren, um darauf reagieren zu können

K wie Klimaaktivismus
Wissen
Die Klimakrise ist real und gefährlich. Trotzdem finden sich überall dort im Netz, wo Nutzer*innen auf die Krise und ihre Folgen aufmerksam machen, täglich zig-fache Beleidigungen, Verschwörungserzählungen und Hetze. Immer wieder werden Klimaaktivist*innen und Wissenschaftler*innen massiv online attackiert. Denn gesellschaftspolitische Themen wie Klimaschutz bieten für die extreme Rechte ein hohes Mobilisierungspotential:
- Rechtsextreme Parteien und Medien sprechen gezielt Klimawandelleugner*innen und -skeptiker*innen an
- Sie hetzen gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung und Politik. Mit Verschwörungsmythen verschleiern sie ihre eigene Ideologie, diskreditieren den wissenschaftlichen Konsens und verhindern insbesondere online einen sachlichen Diskurs
Praktische Tipps
Das kann jede*r tun
- Informiert euch über Quellen und Fakten
- Meldet Desinformationen und Hetze bei sozialen Netzwerken oder Online-Meldestellen
- Entlarvt Strategien der extremen Rechten, indem ihr z.B. Skandalisierung durch Übertreibung und allgemeine Falschbehauptungen benennt
- Bei klimafakten.de findet ihr Tipps und Argumente
für das Entlarven von Desinformationen
Was tun im Shitstorm?
Ausgemachte Shitstorms sind für viele Klimaaktivist*innen und Organisationen mittlerweile Alltag. Was könnt ihr tun, wenn ihr mittendrin steckt?

Vernetzt euch offline und online und bildet Solidaritätsnetzwerke (z.B. mit Partnerorganisationen, lokalen Bündnissen, Berufsverbände, Kolleg*innen, Fachbeauftragte der Länder, z.B. Antidiskriminierungs- und Opferbeauftragte)

Geht gemeinsam vor: Unterstützungsgruppe auf der jeweiligen Plattform, gemeinsame Stellungnahmen und FAQs, Solidaritätshashtag

Achtet auf Sicherheitsvorkehrungen: Überprüft Privatsphäre-Einstellungen und passt Berechtigungen für Apps an. Checkt auch, welche Privatinformationen über Einzelpersonen im Netz zu finden sind.

Wendet euch an professionelle und private Netzwerke: Bittet Partnerorganisationen, Kolleg*innen, Freund*innen und Engagierte um Aufmerksamkeit, Unterstützung und Solidarität.

Bittet Forscher*innen und Fachjournalist*innen sich mit eurem Fall zu beschäftigen: Gibt es Hinweise auf gelenkte Aktionen?

Erklärt öffentlich die Situation (z.B. mit einer Stellungnahme oder einem FAQ) – und sorgt so für Solidarität, wo sonst vielleicht Aufregung oder gar Distanzierung herrschen könnten

Meldet euch für unseren Anti-Shitstorm-Kurs an! Hier gehts zur Anmeldung

L wie „Lügenpresse“
Wissen
Kaum ein Begriff hat seit 2015 so starken Aufwind durch rechtsalternative und -extreme Gruppen und Parteien erfahren wie „Lügenpresse“. Die Diffamierung von Medien und Journalist*innen setzt sich bis heute fort und findet tagtäglich in den sozialen Medien statt.
Der Begriff “Lügenpresse” hat eine lange und traurige Tradition in Deutschland: Bereits 1848 wurde der verschwörungsideologische Kampfbegriff “jüdische Lügenpresse” von konservativen Katholik*innen und später dann im Nationalsozialismus genutzt, um politische Gegner*innen und unabhängige Medien zu verunglimpfen. Der Begriff unterstellt, Medien seien von “Eliten” gesteuert, um die Bevölkerung zu manipulieren. Oft steckt ein antisemitisches Narrativ dahinter, das von einer „jüdischen Verschwörung” ausgeht.
Die Verunglimpfung von Journalist*innen als Vertreter*innen der “Lügenpresse” ist nicht nur faktisch falsch, sondern hat sehr reale Folgen: 2022 gab es 103 Angriffe gegen Journalist*innen, ein Höchststand, der vor allem auf verschwörungsideologische Demonstrationen zurückzuführen ist. Parallel zum Begriff “Lügenpresse” werden häufig Informationen und Meinungen gleichgesetzt. Journalistisch aufbereitetes Faktenwissen wird als beliebig und gleichwertig zur eigenen Meinung dargestellt.
Praktische Tipps
Das könnt ihr Narrative rund um „Lügenpresse“ entgegensetzen

Presse-, Meinungs-, Informations- und Rundfunkfreiheit werden in Deutschland durch Artikel 5 des Grundgesetzes gewährleistet. Medien unterliegen keiner Kontrolle von außen oder Zensur. Im Gegenteil: Viele Medien begleiten die Arbeit von Politiker*innen kritisch und leisten so auch einen Beitrag zur Meinungsbildung in der Demokratie.
Die Sicherung der Meinungsvielfalt ist die Voraussetzung dafür und umgekehrt. Dabei bildet eine Vielzahl verschiedener Medien unterschiedliche politische Meinungen ab. Zahlreiche Einrichtungen und Maßnahmen sorgen für die Vielfaltsicherung.

Berichterstattung folgt journalistischen Standards. Mit dem 16 Punkte umfassenden Pressekodex verpflichten sich die meisten Journalist*innen unter anderem, sorgfältig zu recherchieren, nur nachprüfbare Fakten aus seriösen Quellen zu veröffentlichen und somit die Öffentlichkeit wahrhaft zu informieren, Persönlichkeitsrechte zu wahren, niemanden zu diskriminieren und für die Freiheit der Presse einzustehen.
Um eine freie öffentliche Meinungsbildung zu garantieren, berücksichtigen Medien viele Perspektiven und Auffassungen.

Es ist selbstverständlich legitim und sogar im Pressekodex vorgesehen, Medien zu kritisieren. Und dies geschieht auch von vielen Seiten.
Berichterstattung ist nicht immer frei von Fehlern und Bias. In solchen Fällen können in letzter Instanz sogar Gerichte entscheiden, dass etwa eine Gegendarstellung erfolgen muss. Zudem beeinflussen andere Faktoren Verlage: zum Beispiel die Frage, wann sich welche Medieninhalte gut verkaufen oder die Konkurrenz um Schnelligkeit. Hinzu kommt, dass genau wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft strukturelle Diskriminierung auch vor Redaktionen keinen Halt macht.
Blogs und Soziale Medien, die unreflektierte oder gar gefährliche Berichterstattung aufzeigen und kritisieren, sind z.B. BILDBlog, CORRECTIV oder Übermedien. Gleichzeitig gibt es in Deutschland. Organisationen wie die Neuen Deutschen Medienmacher*innen, die sich dafür einsetzen, dass auch in Redaktionen und Berichterstattung die Vielfalt der Gesellschaft abgebildet wird.
Medien zu kritisieren ist wichtig. Mit dem Narrativ „Lügenpresse“ werden allerdings keine Fehler problematisiert, sondern die Glaubwürdigkeit von Berichterstattung insgesamt untergraben und der Verbreitung von Desinformationen der Weg bereitet.

M wie Memes
Wissen
Memes können so ziemlich alles sein: Von bissiger Gesellschaftskritik auf X über Guten-Morgen-Sonnenschein-Bildchen in Omas WhatsApp-Story bis hin zu rechtsextremer Propaganda auf Imageboards. Politische Memes sind längst Teil der öffentlichen Meinungsbildung im Netz. Der humorvolle Umgang mit gesellschaftlichen Missständen oder Kritik an politischen Anliegen bietet für viele eine einfache Möglichlkeit, sich an politischen Diskussionen zu beteiligen.
Gleichzeitig bleibt der Grad an politischem Engagement niedrig. Wer ein Meme im Netz (re-)postet, kommt mit politischen Themen in Kontakt, ist aber nicht automatisch bereit, Zeit und Energie in andere Formen von politischem Engagement zu investieren. Gerade für die digitale Zivilgesellschaft sind Memes trotzdem ein sehr nützliches Tool, um Aufmerksamkeit auf Themen wie Rechtsextremismus oder Rassismus zu lenken und insbesondere jüngere Nutzer*innen anzusprechen.
Praktische Tipps
Wenn ihr Memes einsetzen wollt, gibt es ein paar Aspekte zu beachten

Setzt ethische Standards: Wann ist es angebracht, humorvoll über Themen zu diskutieren und wann nicht? Seid sensibel mit den Möglichkeiten und Grenzen politischer Sartire.

Kein Digital Blackfacing: Immer wieder nutzen weiße Menschen Memes, in denen Schwarze Menschen im Mittelpunkt stehen und teilweise rassistische Stereotypen reproduziert werden.

Ein gutes Meme tritt nach oben und nicht nach unten: Es kursieren immer wieder Memes, die sich über das Aussehen anderer lustig machen oder rassistische oder antisemitische Ressentiments reproduzieren.

Nicht jedes Thema lässt sich mit einem lustigen Bild abschließend diskutieren. Oft polarisieren und emotionalisieren Memes und überspitzen einzelne Meinungsfragmente. Memes können zur Meinungsbildung beitragen, aber keine fundierte Diskussion ersetzen.

Know Your Meme: Manchmal ist es schwierig den Ursprung eines Memes festzustellen. Teilweise kommen die verwendeten Bilder oder Referenzen aus rechtsextremen Kontexten. Auf der Website „Know Your Meme“ werden die Zusammenhänge dokumentiert.

Meme-Generatoren: Ihr wisst gar nicht wo anfangen beim Erstellen vom Memes? Es gibt zahlreiche Websites und Apps, die dabei helfen, z.B. memegenerator.net. Inspiration für politische Memes findet ihr bei bildmachen.net oder No Hate Speech Movement.

N wie Netiquette
Wissen
Stellt euch folgendes Szenario vor: Ihr veranstaltet eine Lesung und eine Person ruft plötzlich sexistische Sprüche in den Raum. Für die meisten ist es völlig selbstverständlich, dass die Person ermahnt und bei Wiederholung rausgeworfen wird. Wieso gilt das Gleiche eigentlich nicht im digitalen Raum?
Eine Netiquette, also eine digitale Hausordnung, bietet genau diese Möglichkeit. Betreiber*innen von Social Media Seiten oder Webseiten mit Kommentarfunktion können durch klare Regeln den Umgang mit problematischen Kommentaren festlegen. Dies ermöglicht es ihnen, angemessen auf beleidigende, diskriminierende oder anderweitig unangemessene Äußerungen zu reagieren, auch wenn diese beispielsweise unterhalb der Strafbarkeits-Grenze liegen.

O wie Online-Proteste
Wissen
Wer eine Demo bewirbt oder auf ein politisches Anliegen aufmerksam machen möchte, nutzt in den meisten Fällen auch digitale Räume, beispielsweise um Informationen zu verbreiten. In den letzten Jahren setzen politische Aktivist*innen oder Organisationen aber auch vermehrt explizit digitale Protestformen.
Beispiel: Die Online-Demo von Seebrücke
Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie und im ersten Lockdown wollte Seebrücke nicht darauf verzichten, auf die furchtbare Situation in den Geflüchtetenlagern in Griechenland aufmerksam zu machen. Mit einer Online-Demonstration wollten sie Solidarität zeigen und politischen Druck ausüben. in einem Livestream wurden die Online-Demonstrant*innen durch eine digitale Demoroute geführt von Redebeiträge über Petitionen zur Versendung von Handlungsaufforderungen über Websites und Social Media an das Bundesinnenministerium und die EU-Kommission.
Praktische Tipps
Formen von Online-Protest
- Online Petitionen: Startet eine Petition, zum Beispiel über Campact, change.org, openPetition oder auf der digitalen Plattform des Bundestages.
- Social Media Kits: Erstellt Sharepics oder Tweets, die Unterstützer*innen einfach über ihre eigenen Profile teilen können.
- Briefe oder E-Mails an Politiker*innen: Bereitet fertige Schreiben vor, die Unterstützer*innen an ihre jeweiligen Abgeordneten schicken können.
- Hashtag-Kampagne: Nutzt Hashtags um Austausch und Diskussion anzuregen oder auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen.
- Online-Demo: Veranstaltet einen Livestream. Hier gibt es Raum, kreativ zu werden: Integriert Redebeiträge von Supporter*innen, spielt Videos oder Musik ein, ruft zu Massenaktionen in den sozialen Medien auf…
Ihr wollt auch einen Online-Protest organisieren? Folgende Leitfragen können bei der Planung helfen. Je genauer ihr die Antworten aufeinander abstimmt, desto wirkungsvoller könnt ihr euren Protest gestalten.

Worauf möchtet ihr aufmerksam machen?

Wen möchtet ihr aufmerksam machen?

Welche Medienplattformen möchtet ihr verwenden?

Wer könnte euren Protest unterstützen?

P wie psychische Gesundheit & Community-Management
Wissen
Community-Manager*innen sorgen täglich dafür, dass die vernünftigen Stimmen in den Kommentarspalten gehört werden. Aber selbst die Routiniertesten können an Grenzen kommen. Jeden Tag mit Rassismus, Antisemitismus, Beleidigungen, Verleumdungen und sonstigem Mist konfrontiert zu werden, ist keine Bagatelle, sondern eine reale Gewalterfahrung. Psychische Abgrenzung und Selbstfürsorge sind daher entscheidend.
- Selbstsicherheit ist das Fundament: Stärkt eure Entscheidungssicherheit beispielsweise durch Fachaufsätze, Weiterbildungen und Konferenzen
- Diskussionen mit Hater*innen kosten viel Energie: Postet einzelne Statements oder setzt euch für energieraubende Diskussionen begrenzte Zeitfenster.
- Moderation ist Arbeit: Verantwortlichkeiten sollten ein festes Ende haben und nicht in arbeitsfreier Zeit oder Pausen geschehen.
Unterstützung bei akuten Belastungen in Berlin
- ReachOut – Beratung für Betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
- OPRA – Psychologische Beratung für Opfer rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt
- HateAid – Beratungsstelle für Betroffene digitaler Gewalt
- Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR)
- oder bundesweit über die Beratungsstellen für Betroffene rechter und anderer vorurteilsmotivierter Angriffe (VBRG)
Praktische Tipps
Gezielt Räume für Konstruktivität einzuplanen, kann im Community Management helfen, sich emotional abzugrenzen

Nimm dir ausreichend Zeit für Community-Pflege statt negative Kommentare und Mails zu priorisieren.

Beantworte und like regelmäßig für fünf Minuten ausschließlich konstruktive und positive Kommentare.

Folge mit privaten Profilen bewusst Seiten, die dir ein positives Gefühl geben: Reisebloger*innen.
Konstant für mehrere Stunden oder sogar Tage Hassbotschaften ausgesetzt zu sein, ist sehr belastend. Reflektiert negative Erlebnisse:

Tauscht euch im privaten Umfeld über Druck und Belastung aus

Holt euch professionelle Unterstützung, einzeln oder als Team: Supervision.

Sprecht mit Kolleg*innen über Emotionen und Erfahrungen z.B. in einer Intervision.
Intervisionen sind kollegiale Fallberatungen. Sie sind freiwillige Treffen und nicht ergebnisorientiert, es geht um den Austausch. Bei einer Intervision könnt ihr Ratschläge einholen, euch gegenseitig ermutigen oder Dampf ablassen. Solche Treffen können entweder analssbezogen (beispielsweise während/nach einem Shitstorm) oder in regelmäßigen Treffen organisiert werden. Wichtig ist, dass die Gespräche ohne Pläne oder Verabredungen auskommen.

Q wie Quiz
Wissen
Flaute auf dem Feed und in den Kommentaren? Ein Quiz auf euren Kanäle (z.B. in der Instagram-Story) lädt zu mehr Engagement ein, als bloße Information, denn:
- Die Community fühlt sich beteiligt.
- Ein Quiz regt zum Nachdenken und mehr Interaktion ein.
- Quizze bieten Möglichkeiten, direkt mit Nutzer*innen in Kontakt zu kommen.
Praktische Tipps
Ihr wollt ein Quiz starten? Überlegt euch, was das Ziel des Quiz ist. Wollt ihr über ein Thema aufklären? Erfahren, was eure Community interessiert? Oder wie sie zu bestimmten Themen steht? Euer Ziel enstscheidet über das Format:
- Wissenstest
- Persönlichkeitstest
- Umfrage
- Anlassbezogenes Quiz (z.B. zu einem Jahrestag oder Trend)
Ein Quiz soll Spaß machen: Ist es zu schwer, offensichtlich oder spezifisch, steigen viele aus.
- Achtet darauf, einfache und klare Fragen zu stellen.
- Haltet euch kurz: Mehr als 2-3 Minuten sollte es nicht dauern.
- Stellt einen Mehrwert her: Aufbereitete Informationen, Call-to-Action oder ein Bild zum Teilen.
- Bilder und GIFs lockern auf.

R wie rechtsextreme Störstrategien
Wissen
Rechtsextreme Akteure und sogenannte Trolle benutzen in sozialen Netzwerken wiederkehrende Kommunikationsstrategien, mit denen sie eine Diskussion auf Augenhöhe massiv erschweren wollen. Ziel ist es, einen vernünftigen, sachlichen Austausch zu Themen wie Flucht, Rechtsextremismus oder Minderheitenschutz unmöglich zu machen. Störstrategien können angewandt werden um zu provozieren und diskriminieren. Trotzdem handelt es sich bei entsprechenden Kommentaren oder Posts nicht immer um Hate Speech. Das macht es häufig schwierig, angemessen zu reagieren.
Praktische Tipps
Für zwei viel genutzte Strategien stellen wir euch Handlungsoptionen vor: Abwertender Humor und Whataboutism.
Störstrategie I: Abwertender Humor

Abwertende Aussagen werden häufig unter dem Deckmantel von „Humor” verbreitet. Rechtsextreme wollen so herausfinden, wo die Grenzen des Sagbaren liegen. Bei Gegenwind können sie mit einem „Habt euch nicht so” den Spieß umdrehen, sich von der Aussage distanzieren und über die vermeintliche Humorlosigkeit der „politisch Korrekten” schimpfen. Abwertende Aussagen sind für Betroffene aber nicht weniger schmerzhaft, wenn sie als Witz verpackt werden.
Gegenstrategien

- Benenne die Taktik hinter der Strategie. Enttarne den vermeintlichen Humor als Ablenkung und als Versuch, sich gegen Kritik zu immunisieren
- Beziehe Gegenposition und weise diskriminierende Aussagen zurück
- Zeige persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer Aussage auf. Lass dich nicht durch den Vorwurf „Humorlosigkeit” oder „Zensur” aus der Ruhe bringen
Störstrategie II: Whataboutism
![Sprechblase aus einem Chat mit Text: "Und was ist eigentlich mit [beliebiges, völlig anderes Thema einfügen], dazu schweigt ihr?"](https://amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2024/04/Whataboutism-1-1024x400.png)
Es gibt ein Wort für dieses Prinzip, Aussagen durch Gegenaussagen zu beantworten, die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben: Whataboutism.
Hinter solchen Aussagen steckt immer der Vorwurf, ein Thema würde absichtlich nicht besprochen. Deshalb wird diese Strategie als Ablenkungsversuch eingesetzt, um dem Gegenüber Doppelmoral vorzuwerfen. Wer mit solchen Aussagen kommentiert, hat kein Interesse an einem konstruktiven Austausch.
![Zwei Sprechblasen aus einem Chat, in der Ausgangsnachricht steht ""Und was ist eigentlich mit [beliebiges, völlig anderes Thema einfügen], dazu schweigt ihr?". Die Antwort in der zweiten Nachricht lautet: "Ja, auch andere Situationen können schlimm sein. Das macht das ursprüngliche Thema aber nicht weniger wichtig - wir bitten daher, den Themenbezug zu beachten."](https://amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2024/04/Whataboutism-2-1024x400.png)
- Lass dich gar nicht erst inhaltlich auf die Diskussion ein, sondern benenne sie als Störversuch und kehre zum eigentlichen Gesprächsthema zurück.
- Persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen der Aussage aufzeigen: Diskriminierende Aussagen, falsche Informationen oder abwertende Stereotype haben Konsequenzen.

S wie Solidarität
Wissen
Hasserfüllte Stimmen sind im Internet oft laut und aggressiv, die vielen Solidarischen leise. Daher ist es für Angegriffene und Betroffene von Diskriminierung essentiell, dass andere sichtbar Solidarität zeigen. Das gilt sowohl für Situationen in öffentlichen Verkehrsmitteln als auch für die anonyme Masse in der Kommentarspalte.
Viele Betroffene berichten, dass sie unter dem Schweigen der Masse mehr gelitten haben, als unter den Beschimpfungen. Wenn Angegriffene aktiv unterstützt werden, lindert zumindest für die unmittelbare Situation das Gefühl von Ausschluss, glättet das verzerrte Selbstbild und kann ein Stück weit das persönliche Sicherheitsgefühl stärken.
Praktische Tipps
Auch in der Kommentarspalte gilt: Zuschauende greifen oft nicht ein, wenn andere ebenfalls untätig bleiben. Andersherum fühlt sich die Mehrzahl animiert zu helfen, wenn jemand mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn eine Person angegriffen wird, unterstütze sie dabei sich selbst zu verteidigen.
Angegriffene unterstützen und intervenieren

Achte darauf, die Person nicht in eine passive Opferrolle zu drängen. Sie sollte die Handlungsmacht über die Situation haben.

Sende per privater Nachricht oder e-Mail eine virtuelle Umarmung.

Frage nach, ob bisherige Reaktionen hilfreich waren und welche weitere Unterstützung sie sich wünscht.

Auch wenn eine ganze Gruppe von Menschen abgewertet wird, können wir solidarisch handeln – denn auch hier bleibt Hass nicht folgenlos. Widersprich per Post oder Kommentar menschenverachtenden Aussagen.

Bekunde öffentlich deine Solidarität.
Schon ein einfaches „Nein, das sehe ich anders!“ gibt den Mitlesenden die Möglichkeit, sich zwischen Meinungen zu entscheiden. So können wir eine demokratische Debattenkultur stärken.
Solidarität organisieren
Ihr selbst oder eure Organisation stecken mitten in einer Hasskampagnen? Viele bekommen vielleicht gar nicht mit, was Ihr erlebt. Schafft die Sichtbarkeit

Bittet Partnerorganisationen, Berufsverband, Kolleg*innen, Freund*innen und Engagierte um Aufmerksamkeit, Unterstützung und Solidarität.

Organisiert eine Unterstützungsgruppe mit Verbündeten: So könnt Ihr euch schnell, gegenseitig informieren, wenn Unterstützung gewünscht ist.

Schildert in einem Post oder Artikel Eure Situation. Macht es euren Follower*innen leicht, Solidarität zu zeigen und erstellt Soli-Grafiken, Formulierungshilfen oder einen Hashtag.

U wie Umwegkommunikation
Wissen
Rechtsextreme und Antidemokrat*innen finden immer wieder neue Wege um in den sozialen Medien den Diskurs zu kapern. Ein Beispiel dafür ist Umwegkommunikation: Mit komplizierten Metaphoriken versuchen sie Unsagbares zu normalisieren und Nutzer*innen für ihre Ideologien zu gewinnen. Mit Umwegkommunikation wollen Rechtsextreme:
- menschenfeindliche Ideologien transportieren, ohne von Social Media-Nutzer*innen gleich als rechtsextrem erkannt zu werden
- Restriktionen der sozialen Netzwerke umschiffen, z.B. Accountsperren, das Blockieren von Begriffen oder Shadowbans, also reduzierte Reichweite
- Mittel: harmlos scheinende Videos, die Ideologien via Sound, geänderten Worten, oder Emojis transportieren. Zum Beispiel wurden Memes von Gartenzwergen zur antisemitischen Chiffre, weil die Mützen an den mittelalterlichen Judenhut erinnern
Praktische Tipps
Umwegkommunikation ist für die technische Moderation der Plattformen schwer zu erkennen, daher braucht es vielfältige Ansätze um gegen sie vorzugehen:
- Als Social-Media-Redakteur*in: regelmäßige Auseinandersetzung mit Sprache und Memes der extremen Rechten. Updates dazu gibt es z.B. regelmäßig bei Belltower.News.
- Medienbildung, um Nutzer*innen über Umwegkommunikation aufzuklären, beispielsweise mit Digital Streetwork oder eigenen Postings
- Wenn du Umwegkommunikation erkennst: Inhalte melden und in den Kommentaren darauf hinweisen

V wie Verschwörungserzählung
Wissen
Der Umgang mit Verschwörungserzählungen in der Kommentarspalte ist kompliziert. Auch wenn der erste Impuls oft ist, in die Diskussion zu gehen: Bei Personen mit geschlossenen Weltbildern ist eine konstruktive Debatte per Kommentar nahezu unmöglich.
Aber Gegenrede hat trotzdem Auswirkungen auf mitlesende Dritte. Verschwörungsideologische Kommentare enthalten oft (teils verdeckt, teils offen) ein autoritäres Weltbild und antisemitische Elemente. Hier ist es wichtig, zu intervenieren und Kritik zu üben.
Die Journalistin Ingrid Brodnig beleuchtet in ihrem Buch Einspruch! welche Effekte Diskussionen in den sozialen Medien haben können: Sobald mindestens zwei Nutzer*innen verschwörungsideologischen Inhalten widersprechen und Faktenchecks posten, zeigt sich eine positive Wirkung auf Mitleser*innen.
Praktische Tipps
Es gibt einige Handlungsoptionen bei Verschwörungserzählungen in der Kommentarspalte.

Menschenfeindliche Inhalte oder Desinformation melden

Grenzen des Sagbaren in Bezug auf Antisemitismus und andere Menschenfeindlichkeit deutlich ziehen


Nachfragen, wie Kommentare gemeint sind, wenn Inhalt oder Intention unklar sind

Faktenchecks und Quellen verlinken, auch dann, wenn bereits andere kommentiert haben (Mehr dazu unter F wie Faktencheck)

W wie Wissenschaftsfeindlichkeit
Wissen

Zwei Drittel aller Wissenschaftler*innen halten öffentliche Anfeindungen für eine ernsthafte Bedrohung der Wissenschaft.

Mehr als die Hälfte hält es für möglich, selbst Opfer von Anfeindungen zu werden, wennsie sich öffentlich äußern. (Quelle: Heinrich Heine Universität Düsseldorf)
Wissenschaftsfeindlichkeit ist eine direkte Gefahr für die Demokratie. Je weniger Wissenschaftler*innen sich trauen, in der Öffentlichkeit zu sprechen, insbesondere zu dringlichen Themen wie Klimakrise oder Gesundheit, desto weniger offen zugänglich sind faktenbasierte Argumente. Offene Wissenschaftskommunikation ist wichtig für fundierte Wissens- und Meinungsbildung. Wissenschaftsfeindlichkeit muss von wissenschaftlichen Institutionen und politischen Vertreter*innen mitgedacht werden, damit wissenschaftliche Beteiligung am öffentlichen Diskurs weiter stattfinden und gefördert werden kann.
Praktische Tipps
Das hilft gegen Wissenschaftsfeindlichkeit.
Scicomm-Support setzt sich für einen demokratischen Wissenschaftsdiskurs ein und will das Wissenschaftssystem resilienter gegen Hate Speech und weitere Formen von Wissenschaftsfeindlichkeit machen. Dazu beraten sie Betroffene kostenlos und stellen Informationen und Ressourcen sowie Traingsangebote zur Verfügung auf www.scicomm-support.de.
Selbstschutz
Du bist Wissenschaftler*in oder Ärzt*in und willst in der Öffentlichkeit über Gender Studies, Corona, Sicherheits-politik usw. sprechen? Geh vorher diese Checkliste durch!

Google dich: Wie viele Informationen sind über dich öffentlich verfügbar? Und: Soll das auch so sein?

Google auch deinen Namen zusammen mit Universität, Wohnort usw. Findet man dich, deine Geschwister, Kinder, Eltern?

Rechne damit, dass Angreifer*innen versuchen, so viele Informationen über dich zusammenzutragen wie möglich – ist irgendwo z.B. deine Privatdresse zu finden? (z.B. Ortsmarkierungen, Vereine, Markierungen durch Freund*innen usw.)

Willst du eine Telefonnummer online haben?

Wie gut musst du auf Profilfotos zu erkennen sein?

Familien- und Kinderbilder sollten privat sein, ebenso Fotos und Adressen vom Wohnhaus, Schule, Auto usw.; Freundeslisten, Vorlieben…

Es gibt Berichterstattung über dich, in der private Informationen (Schule, Vorlieben, Freund*innen) vorkommen? Bitte um eine Offline-Stellung der Beiträge.

X wie Twitter
Wissen
Der Niedergang von Twitter: Eine (unvollständige) Timeline
Praktische Tipps
Angesichts des Ausmaßes an Hetze und Desinformationen ist mittlerweile kaum noch vernünftiger Diskurs auf X möglich. Seriöse Medien können zwar ein Gegengewicht zu Desinformationen bilden. Aber je mehr Nutzer*innen X verlassen, desto weniger Aufmerksamkeit für ein Netzwerk, auf dem gerade Menschenfeinde massiv Land gewinnen. Aktuell ist es auch mit viel Moderation kaum noch möglich, die eigene Community vor rassistischen, antisemitischen und sonstigen Angriffen zu schützen.
Alternativen zu X/Twitter
Mastodon
- gemeinwohlorientierte und dezentrale Kommunikationsinfrastruktur
- ca. 12 Mio. Nutzer*innen
- keine Algorithmen: vorrangig Inhalte aus der eigenen Community
- Variierende Moderationsregeln und -praktiken auf unterschiedliche Mastodon-Instanzen, die meistens weitergehen als rechtliche Grundlage
Bluesky
- Venture Capital finanziertes Netzwerk mit noch unklarem Geschäftsmodell
- ca. 2,5 Mio. Nutzer*innen
- es können Blocklisten angelegt und/oder gefolgt werden
- Das Netzwerk arbeitet aktuell an automatischen Tools für die Moderation von Inhalten
- Erinnerungsfunktion für Alt Texte
Threads
- Kurznachrichtendienst von Meta, der an Instagram geknüpft ist Instagram-Account ist zur Nutzung notwendig
- ca. 160 Mio. Nutzer*innen
- Inhalte werden nur geprüft und moderiert, wenn sie von Nutzer*innen gemeldet werden.

Y wie YouTube-Livestream
Wissen
Spätestens seit Corona finden viele Veranstaltungen als YouTube-Livestreams statt. Der begleitende Livechat ermöglicht es den Teilnehmenden, in Echtzeit mit den Personen im Stream zu interagieren und Fragen zu stellen. Häufig werden Livechats allerdings auch für Hassrede und gezielte Trollaktionen missbraucht.
Praktische Tipps
Bei einem YouTube Livestream könnt ihr mindestens eine*n Moderator*in festlegen, die Kommentare prüfen und verwalten. Moderator*innen sollten zumindest Hate Speech screenshotten und anschließend löschen sowie Troll-Accounts sperren.
Voreinstellungen

Wörter sperren: Vor dem Stream könnt ihr Wörter festlegen, die automatisch gefiltert werden, sodass Nachrichten mit bestimmten Begriffen gar nicht erst gesendet werden können.

Langsamer Modus: In den Einstellungen des Livestreams könnt ihr vorher den langsamen Modus festlegen, sodass Nutzer*innen nicht beliebig viele Kommentare direkt hintereinander posten können. Das macht Sinn, weil es zu Trollstrategien gehört sehr viel und immer wieder das gleiche zu posten.
Während des Livechats

Eröffnungskommentar: Postet zu Beginn des Livechats einen Kommentar, der auf die Moderationsregeln und ggf. eure Netiquett verweist. Es ist auch sinnvoll im Verlauf des Livestreams immer wieder auf die passende Tonalität und Netiquette aufmerksam zu machen.

Eröffnungskommentar: Postet zu Beginn des Livechats einen Kommentar, der auf die Moderationsregeln und ggf. eure Netiquett verweist. Es ist auch sinnvoll im Verlauf des Livestreams immer wieder auf die passende Tonalität und Netiquette aufmerksam zu machen.
Nach dem Livechat

Chatwiedergabe: Wenn der Livestream weiterhin online bleibt, wird standardmäßig der Livechat genauso wiedergegeben, wie er während des Streams verlaufen ist. Das bedeutet, wenn es Hassrede oder Trolling gab, werden sie trotz anschließendem Löschen kurz angezeigt. Wählt in diesem Fall aus, dass die Chatwiedergabe nicht mehr angezeigt werden soll.

Screenshots sichten: Prüft nach dem Livechat die Screenshots auf strafbare Aussagen und heftige Anfeindungen. Erstattet ggf. Anzeige.

Z wie Zivilgesellschaft
Wissen
Stündlich werden Nutzer*innen, ganze Gruppen oder Institutionen im Netz beschimpft, belästigt und bedroht. Betroffene fühlen sich allein gelassen. Es ist wichtig, dass sich Andere in solchen Situationen einschreiten und auch online zivilcouragiert handeln. Eine aktive digitale Zivilgesellschaft muss online genauso engagiert sein gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus wie auf der Straße, in Betrieben oder in den Parlamenten! Die digitale Zivilgesellschaft, das sind wir alle. Und Engagement kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben Nutzer*innen gefragt, wie und weshalb sie sich online engagieren.