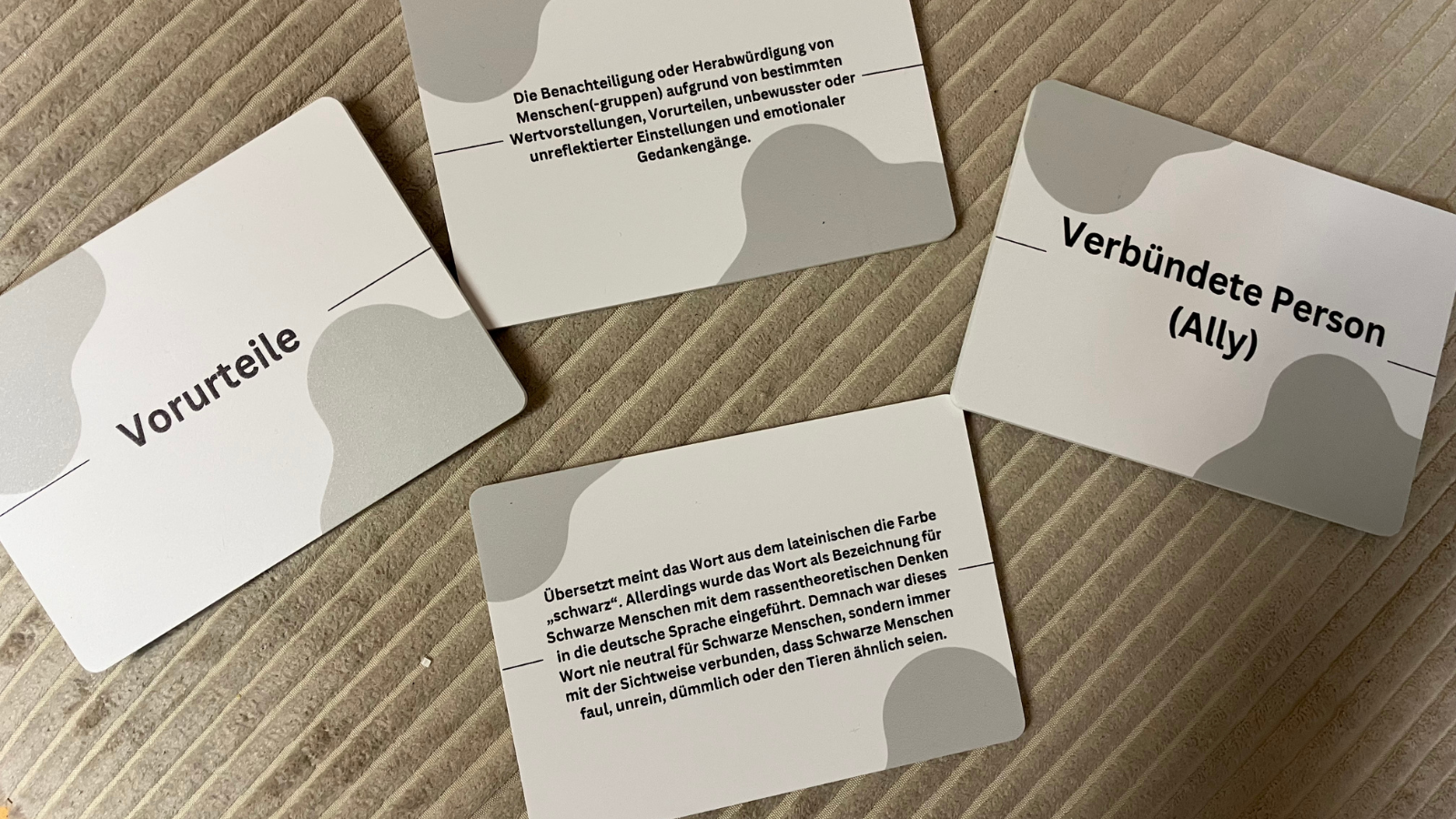Vom 3. Juni bis 3. Juli 2016 ist die Sonderausstellung „AugenBlicke“ im baden-württembergischen Laupheim zu sehen. Sie setzt die Gefühlswelt von Geflüchteten in den Fokus des Betrachters.
von Mick Prinz
Neben denen, die aktuell flüchtlingsfeindliche Stimmung verbreiten, gibt es das nicht nachlassende Engagement zahlreicher Menschen, die sich mit Geflüchteten solidarisieren und sich für eine tolerante und multikulturelle Gesellschaft aussprechen. Doch auch engagierte Freiwillige, die sich für eine breite Willkommenskultur einsetzen, sprechen häufig davon, „den Flüchtlingen“ helfen zu wollen und dass „diese“ in gesellschaftliche Prozesse einbezogen werden sollten.
Um Vorurteile, Misstrauen und mangelnde Kommunikation abzubauen und aufzuzeigen, wer „die“ überhaupt sind, hat die Photographin Laura Zalenga im Landkreis Biberbach untergekommene Geflüchtete porträtiert. Mit der Sonderausstellung, die von der Amadeu Antonio Stiftung gefördert wird, soll im Museum zur Geschichte von Christen und Juden eine Auseinandersetzung der lokalen Bevölkerung mit den Themen Migration, Flucht und Asyl angeregt werden. Die 44 Portraits zeigen zwei verschiedene emotionale Zustände – fröhlich und traurig – und spiegeln die meist sehr ambivalente Gefühlswelt vieler Geflüchteter wider: einerseits die neue Lebensperspektive, die neuen Chancen und den Schutz vor Krieg und Verfolgung, und andererseits die Ungewissheit, Sorge um Angehörige, Heimweh sowie die Konfrontation mit rassistischen Anfeindungen. Die Ausstellung „AugenBlicke“ folgt dem Anliegen, die Schutzsuchenden aus der anonymen Masse herauszuheben und zu unterstreichen, dass die Auseinandersetzung mit Flucht und Asyl eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, hinter der viele persönliche Schicksale stehen.
Eine weitere Besonderheit der Ausstellung ist, dass viele Möglichkeiten der Interaktion und Teilhabe geboten werden. Das Museum wird zu einem Begegnungsort, an dem nicht nur die Folgen und Konsequenzen von Rassismus sichtbar gemacht werden. An konkreten Mitmachtagen wird ein Raum für interkulturelle Begegnungen zwischen der lokalen Bevölkerung und den Geflüchteten geschaffen. Berührungsängste, Vorurteile und Misstrauen werden durch das gegenseitige Kennenlernen und den interkulturellen Austausch abgebaut. Besucher_innen können sich außerdem mit einem verschriftlichten Statement von Laura Zalenga fotografieren lassen und werden so Teil der Ausstellung. Die hier entstehenden Fotos werden auf der abschließenden Finissage vorgestellt und stehen symbolisch für eine demokratische Gegenkultur zum rechten Mainstream. Ein weiteres Ziel der Mitmachtage ist es, Jugendliche, politische Vertreter_innen, Geflüchtete und Stellvertretende von Migrantenselbstorganisationen und -wirtschaftsunternehmen zusammen und ins Gespräch zu bringen. Darüber hinaus verfolgt das Projektvorhaben einen pädagogischen Ansatz. In der an das Museum angegliederten Lernwerkstatt erarbeiten Schulklassen unterschiedlichste Beiträge, die kontinuierlich in die Sonderausstellung integriert werden.