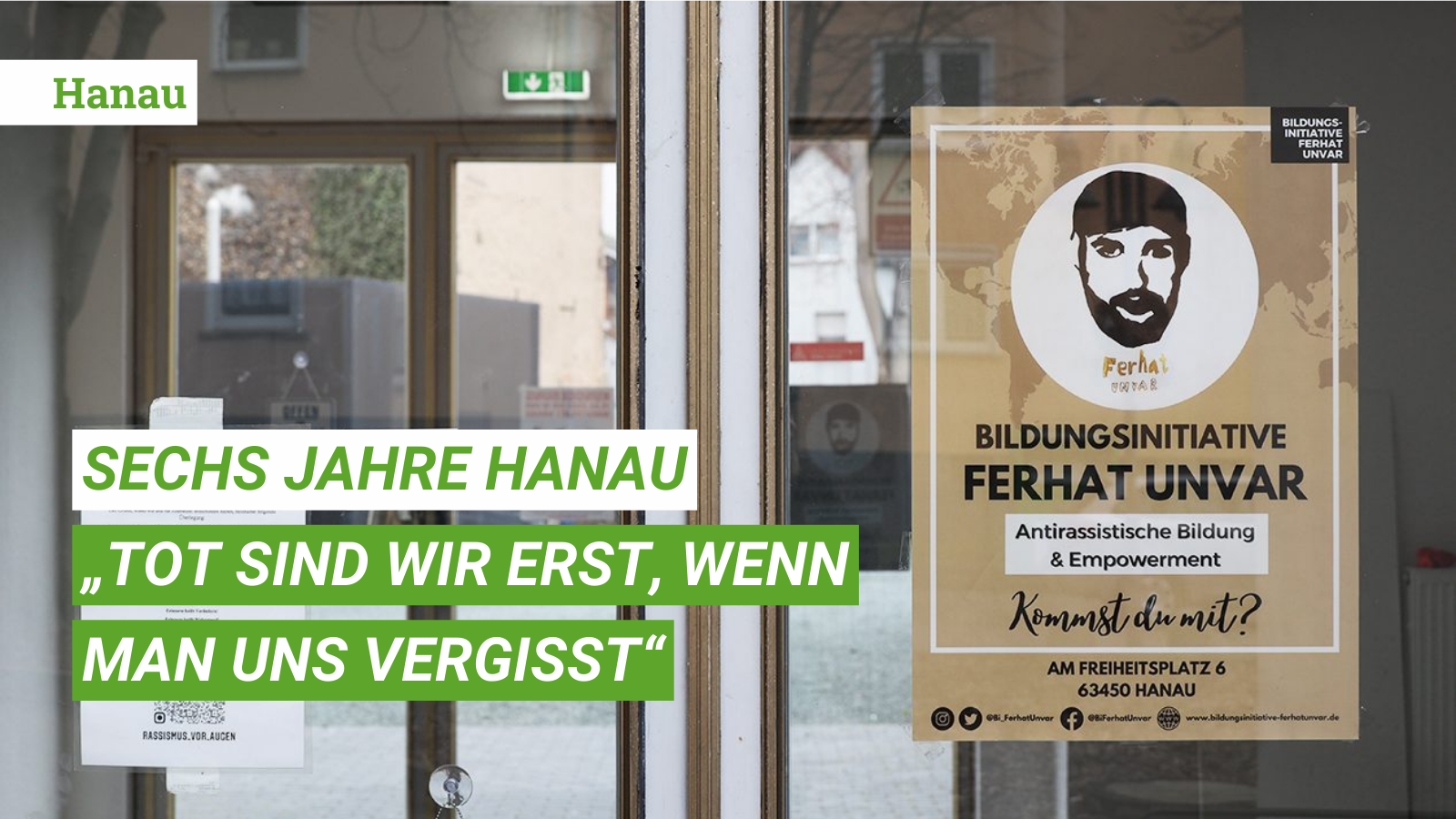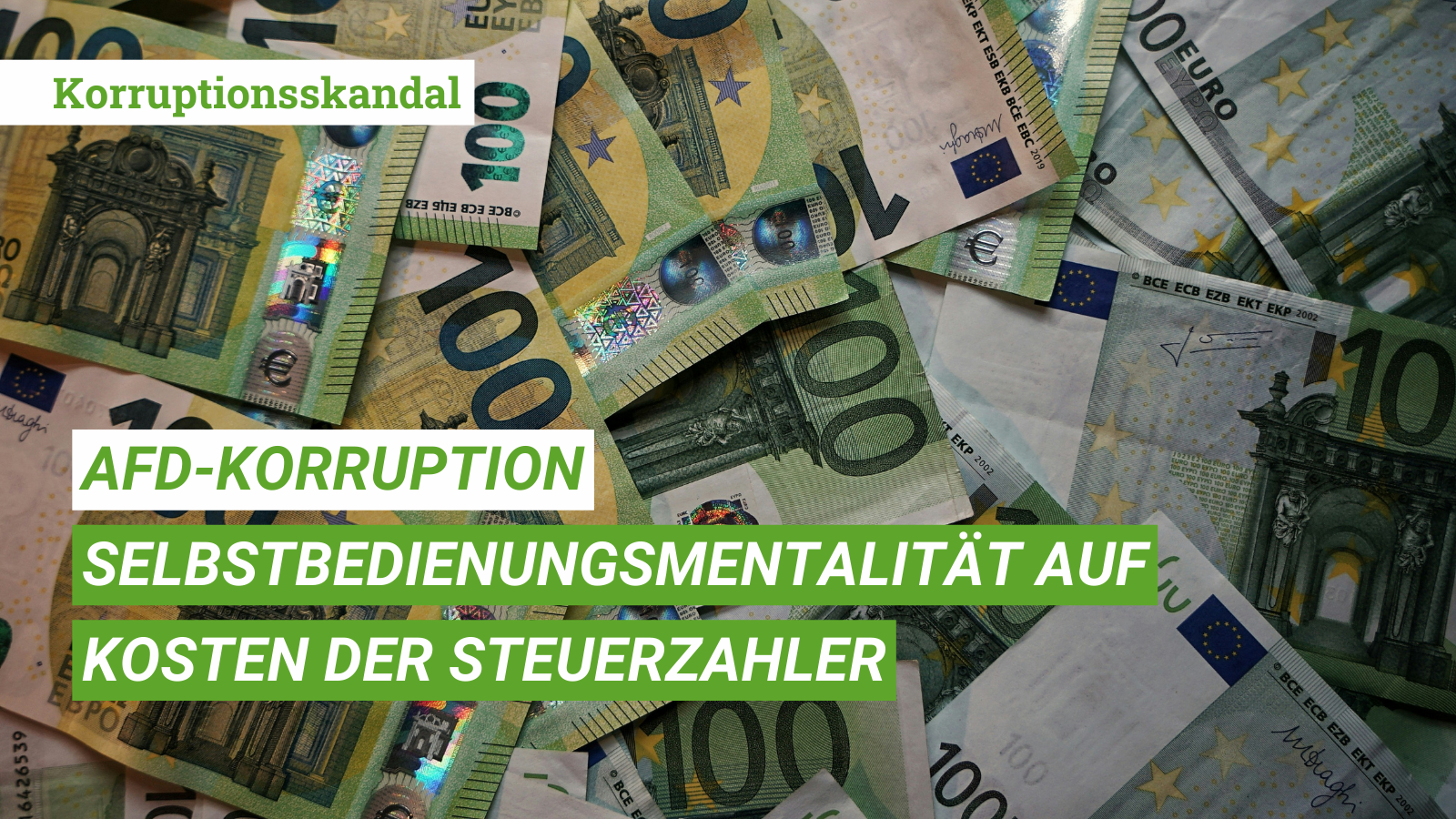Sieben Jahre nach den rechtsextremen Gewaltexzessen von Chemnitz kommen die Angeklagten vor Gericht mit Freisprüchen und Einstellungen davon. Polizei und Justiz behandeln schwere politische Gewaltstraftaten wie Bagatelldelikte. Das verhöhnt die Opfer und ermutigt rechte Täter – nicht zum ersten Mal. Ein Kommentar.
Von Michael Kraske
Ich kann mich noch gut an mein Interview mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer erinnern, kurz nach den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz, im heißen Spätsommer 2018. Der CDU-Politiker wollte angesichts der erschütternden Ereignisse unbedingt Härte demonstrieren. Zur Erinnerung: Nach einem Tötungsdelikt an einem Chemnitzer Bürger hatte die rechtsextreme Szene überregional zu Demos mobilisiert, woraufhin Neonazis aus ganz Deutschland in der Stadt aufmarschierten. Rechte Hooligans machten am Rande von Demos Jagd auf Migrant*innen, Medienleute und Menschen, die gegen Rassismus demonstrierten. Es gab etliche Körperverletzungen, ein jüdisches Restaurant wurde angegriffen. Die AfD übte auf der Straße den Schulterschluss mit der Neonazi-Szene. Bei einer als Trauerzug getarnten Demo war auch der spätere Mörder von Walter Lübcke vor Ort. Stephan E. sah Chemnitz als Fanal an, das den Anstoß gab, zum Mörder zu werden. Im Anschluss an den sogenannten „Trauermarsch“ von AfD, Pegida, Neonazis und Wutbürgern explodierte die rechte Gewalt in der Stadt. Gegendemonstrant*innen, die bei „Herz statt Hetze“ waren, wurden überfallen, bedroht, geschlagen und getreten.
Enthemmte Neonazigruppen sowie eine zögerliche, unterbesetzte Polizei, die dem Mob phasenweise die Macht über die Straße überließ. Damit konfrontierte ich seinerzeit im Interview für das Medienmagazin journalist den sächsischen Ministerpräsidenten. Kritik bügelte Kretschmer pauschal ab. Vollmundig kündigte er an: „Wir werden die Täter mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgen und zur Verantwortung ziehen.“ Sieben Jahre später ist klar: Der Staat hat sein Versprechen gebrochen. Das fatale Signal der Strafverfolgungsbehörden lautet: Systematische rechte Straßengewalt bleibt nahezu folgenlos. Wer nicht nur wehrlose Opfer, sondern auch diesen Staat und dessen Gewaltmonopol offen von rechts angreift, hat wenig bis gar nichts zu befürchten.
Schon vor einem Jahr waren dem MDR zufolge von 142 eingeleiteten Ermittlungsverfahren bereits 97 eingestellt worden. Einige der brutalsten Angriffe sollten als Sammelprozesse mit mehreren Angeklagten verhandelt werden. Doch jahrelang passierte so gut wie nichts. So hat es fünfeinhalb Jahre gedauert, bis am Landgericht Chemnitz im Januar 2024 ein großer Prozess endete. Gegen drei von ursprünglich neun Angeklagten wurden die Strafverfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von je 1.000 Euro eingestellt. Dafür mussten sie nur pauschal zugeben, an Angriffen auf Gegendemonstrant*innen beteiligt gewesen zu sein. Schon vor dem Prozess waren zwei Neonazis untergetaucht. Andere Verfahren waren bereits zum Prozessbeginn eingestellt worden. Ein weiterer Strafprozess wurde noch länger verschleppt. Sieben Jahre nach den brutalen Angriffen hat das Chemnitzer Landgericht nunmehr drei Angeklagte freigesprochen. Das Verfahren gegen einen Braunschweiger Neonazi wurde ohne Auflagen eingestellt.
Sieben Jahre auf ein Urteil warten zu müssen, ist eine Farce für die Opfer. Sieben Jahre lang können sie mit der traumatischen Erfahrung nicht abschließen. Sieben Jahre bleibt politische Gewalt ungesühnt. Die Begründungen der Justiz für die verschleppte Aufarbeitung sind völlig inakzeptabel. Weder Corona noch ein Personal- oder Kammerwechsel rechtfertigen es, Verfahren, an denen ein eminentes öffentliches Interesse besteht, derart lange aufzuschieben. Abgesehen von eiligen Haftsachen, die stets Vorrang haben, müssen Gerichte ständig Prioritäten setzen. Politisch motivierte Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit, die der Machtdemonstration dienen und Gegner*innen mundtot machen sollen, so lange wie eine Lappalie zu behandeln, bis den Angeklagten allein aufgrund der überlangen Verfahrensdauer mildeste Urteile zustehen, ist geradezu unanständig.
Nach mehreren Jahren können sich Geschädigte und Zeug*innen erwartungsgemäß an vieles nicht mehr erinnern. Bei einem so komplexen Geschehen wie dem Angriff einer Gruppe rechter Schläger bedeutet juristisches Zeitspiel nichts anderes als Täterschutz. Prozessbeobachter*innen der Opferberatung RAA Sachsen haben gleichwohl dokumentiert, dass die Betroffenen vor Gericht sehr wohl detaillierte Tatabläufe geschildert haben. Demnach haben diverse Zeug*innen, die zuvor an der Kundgebung „Herz statt Hetze“ teilnahmen, einzelne Angeklagte eindeutig als Teil der Tätergruppe erkannt. Sie bezeugten Schlachtrufe wie „Adolf Hitler, unser Führer“ und „Zecken“ sowie diverse Tritte und Schläge – auch gegen den Kopf von Opfern. Einige Geschädigte, die mit einem Reisebus aus Marburg zur Gegendemo angereist waren, registrierten Schlagwerkzeuge, die Baseballschlägern glichen. An einem anderen Prozesstag beschrieben Zeug*innen den Braunschweiger Neonazi als besonders aggressiven Wortführer, der auch handgreiflich geworden sei.
Dass das Gericht konkrete Körperverletzungen letztlich nicht zweifelsfrei einzelnen Angeklagten zuordnen konnte und im Ergebnis zu Freisprüchen kam, hat auch mit Erinnerungslücken der ermittelnden Polizeibeamten zu tun. Prozessbeobachter*innen berichten von Aussagen, in denen die Beamten angaben, sich kaum erinnern zu können und darüber hinaus aussagten, es gebe gar keine Akten mehr zu dem Fall. Ein Beamter habe sich darauf berufen, dass entsprechende Daten bereits wie üblich aus dem polizeilichen Auskunftssystem gelöscht wurden. Folgerichtig habe er seine Aussage vor Gericht auch nicht vorbereiten können. So sieht die von Ministerpräsident Kretschmer angekündigte volle Härte des Rechtsstaates dann in der sächsischen Praxis aus.
Obwohl Zeug*innen übereinstimmend aussagten, dass die Angriffe auf Personen, die zuvor bei „Herz statt Hetze“ waren, jeweils überfallartig durch eine Gruppe erfolgten, zog das Gericht eine Verurteilung wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung offenbar nicht ernsthaft in Erwägung. Und für Landfriedensbruch reichte es aufgrund der Anzahl der Angreifer nicht. Entsprechend harsch fällt die Kritik der Nebenklagevertreter*innen aus. „Dieses Verfahren ist ein Freifahrtschein für den randalierenden rechten Mob“, so Anwältin Kati Lang, die einen Chemnitzer Mandanten vertritt. „Erst wird schlampig ermittelt, dann das Verfahren jahrelang durch die Justiz verschleppt und schlussendlich freigesprochen.“
Opferberaterin Anna Schramm, die Geschädigte für die Beratungsstelle Support durch den Prozess begleitet hat, berichtet, dass die Straflosigkeit der Täter für die Betroffenen „ein schwerer Schlag“ sei. Sie bleiben nicht nur ohne eine juristische Anerkennung ihrer Gewalterfahrung zurück, sondern auch auf hohen Prozesskosten sitzen. Der Umgang der sächsischen Polizei und Justiz mit der organisierten rechten Gewalt erschüttert das Vertrauen in den Rechtsstaat. Er habe lernen müssen, so ein verbitterter Nebenkläger, „dass Neonazis von der Justiz in Sachsen nichts zu befürchten haben, wenn sie in einem Mob auf politische Gegner*innen losgehen“.
Der Chemnitz-Skandal, das macht es so brisant, reiht sich in ein beunruhigendes Muster ein. Auch das Verfahren wegen brutaler Überfälle der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung „Faust des Ostens“ aus dem Umfeld von Dynamo Dresden wurde vom Landgericht Dresden derart lange verschleppt, bis die Täter acht Jahre nach Anklageerhebung mit milden Strafen davonkamen. Über viele Jahre zog sich auch die juristische Aufarbeitung des Neonazi-Überfalls auf den alternativen Leipziger Stadtteil Connewitz vor dem Amtsgericht Leipzig hin. Anstatt die Hintergründe über Absprachen, Netzwerke und Drahtzieher des marodierenden rechten Mobs umfassend aufzuklären, ließ sich das Gericht auf fragwürdige Deals ein. Im Januar 2016 hatten sich rund 200 rechtsextreme Gewalttäter auf einem Parkplatz verabredet und waren anschließend durch Connewitz gezogen, wo sie Anwohner und Läden angriffen. Etliche Täter kamen mit Geldstrafen davon, wenn sie vor Gericht nur zugaben, irgendwie dabei gewesen zu sein. Viele gaben an, nur kurz, zufällig oder ganz hinten im Sturmtrupp mitgelaufen zu sein. Die rechtsextremen Netzwerke hinter dem orchestrierten Angriff blieben unbehelligt. Immer wieder explodiert in Sachsen rechte Gewalt – immer wieder bleibt das nahezu folgenlos.
Seit Jahren erreichen rechte Gewaltstraftaten bundesweit neue Rekordmarken. Der Staat steht in der doppelten Pflicht, Opfer wirksam zu schützen und Tätern vor allem durch konsequente Strafverfolgung die rechtsstaatlichen Grenzen aufzuzeigen. Das bedeutet: Gründliche Ermittlungen, zügige Verfahren, angemessene Strafen. Sachsen zeigt seit Jahren, wie es nicht geht. Die Folgen sind fatal. Die rechtsextreme Szene kann diese demonstrative Nachsicht des Rechtsstaats nur so verstehen, dass systematische politische Gewalt nicht kategorisch als Tabubruch geächtet wird. Die deutschen Sicherheitsbehörden beobachten aktuell, dass eine junge, militante Neonazi-Generation heranwächst, in der mutmaßlich auch neue rechtsterroristische Strukturen entstehen. Die richtige Antwort darauf ist rechtsstaatliche Härte. Stattdessen ist der Lerneffekt aus dem Chemnitz-Komplex: Rechte Gewalttäter haben so gut wie nichts zu befürchten.
Ebenso fatal ist die Botschaft an jene Menschen, die bereit sind, für Demokratie auf die Straße zu gehen. Etliche von denen, die in Chemnitz nach „Herz statt Hetze“ auf die Straße gegangen sind und dafür bedroht, beleidigt, geschlagen und getreten wurden, haben den Glauben an den Rechtsstaat verloren. Ihnen und allen anderen, die sich Neonazis und Rassist*innen entgegenstellen, wird signalisiert: Ihr steht allein da. Auf den Schutz des Staates könnt ihr euch nicht verlassen. Dass der Rechtsstaat auch ganz anders kann, zeigt er beispielsweise, wenn es um Klimaaktivist*innen geht, die sich auf Straßen kleben oder den Flugbetrieb stören. Da werden dann schon mal zügig Haftstrafen verhängt. Offenkundig gibt es hierzulande je nach Täterprofil und Deliktart ganz unterschiedlichen Ermittlungseifer. Das darf nicht sein. Um marodierende Neonazis, die auf der Straße Menschen jagen und verletzen, rechtsstaatlich sauber abzuurteilen, braucht es keinen übermäßigen Verfolgungseifer – nur die Einhaltung polizeilicher und juristischer Standards. In Politik und Justiz wird offenbar immer noch nicht verstanden, was auf dem Spiel steht.
Der Artikel erschien ursprünglich bei Belltower.News.