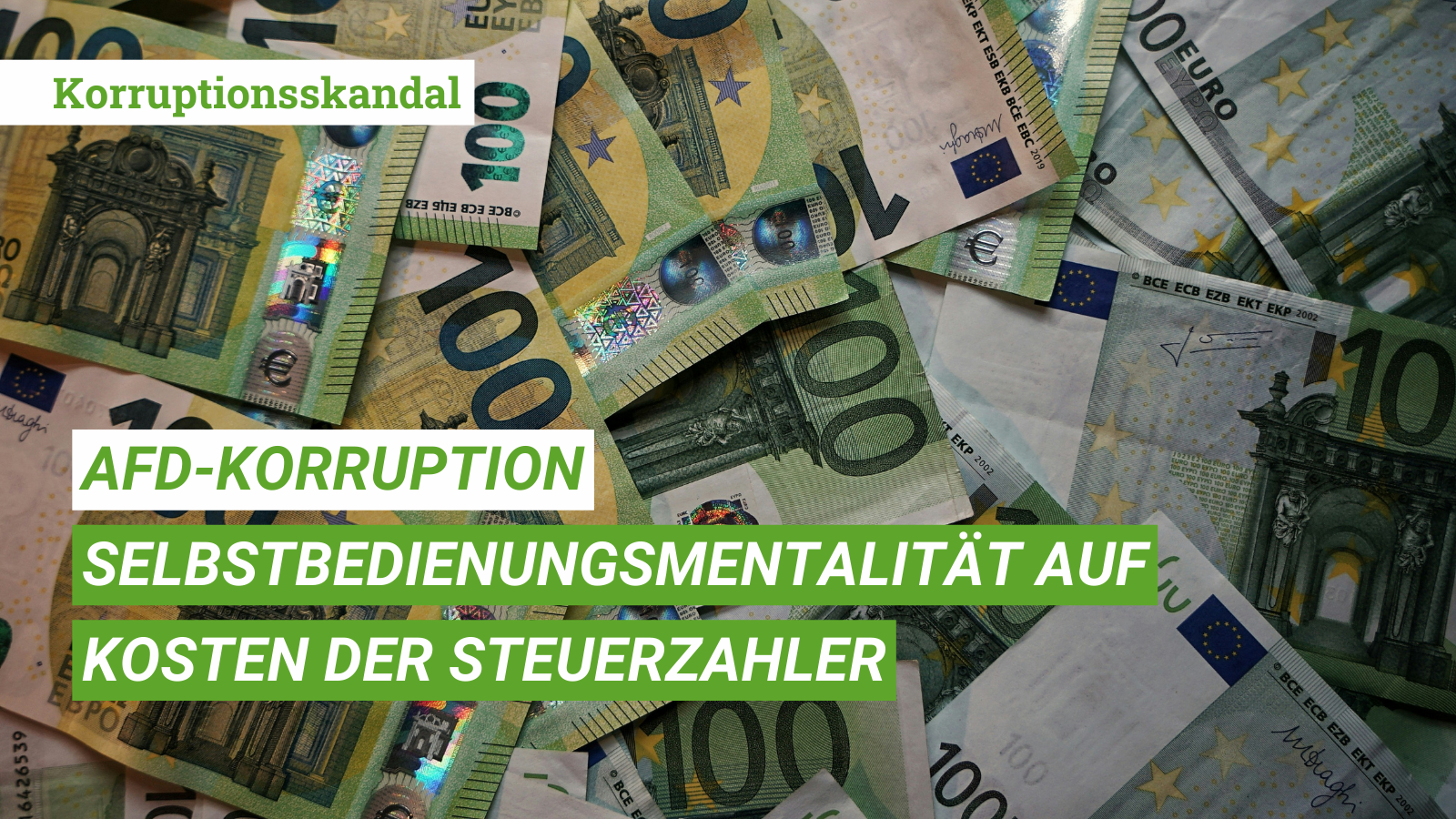Den polemischen und herabsetzenden Begriff „Lügenpresse“ gibt es schon mindestens seit dem 19. Jahrhundert. Besonders beliebt war er allerdings im Nationalsozialismus, bevor er bei den Demonstrationen der islamfeindlichen und rechtsextremen Organisation Pegida 2012 sein Comeback feierte. „Lügenpresse“-Sprechchöre sind seitdem von keinem Rechtsaußen-Event mehr wegzudenken und auch die AfD hat den Begriff für sich vereinnahmt.
Dabei unternimmt die Partei inhaltlich widersprüchliche Volten: Passen die Nachrichten der von ihr so bezeichneten „Systemmedien“ zu ihren Kampagnenthemen, zitieren sie gerne die entsprechenden Schlagzeilen – oder verbiegen sie derart, dass sie vermeintlich passen. Wenn dieselben Medien aber Menschenverachtung, Rassismus oder Antisemitismus in den Reihen der AfD oder ihrer Unterstützer*innen kritisieren, sind Fakten plötzlich Lügen. Gegen diese angeblichen Lügen geht ausgerechnet die Partei, welche sich selbst als Schild und Schwert der Meinungsfreiheit stilisiert, vehement vor – sei es, indem sie missliebige Meinungen diskreditiert oder versucht, juristisch dagegen vorzugehen. Regelmäßig versucht die AfD zudem, etablierte Medien von Parteitagen oder Wahlkampfveranstaltungen auszuschließen. Die grundgesetzlich garantierte Pressefreiheit spielt dabei natürlich keine Rolle.
Am liebsten konstruiert die Partei für ihre Anhänger*innen aber eine eigene Wirklichkeit: weit weg von Fakten, Demokratie und Wahrheit. In den sozialen Medien und in einem ganzen Ökosystem parteinaher oder parteieigener Medien herrschen vor allem Fake News, gefühlte Wahrheiten und Desinformation vor. Bei medienverdrossenen Menschen können diese Botschaften verfangen. Schlimmstenfalls radikalisieren sich diese und verbreiten Verschwörungsmythen oder Gewaltphantasien gegenüber Journalist*innen.
Das zeigt Wirkung: Immer wieder kommt es zu Übergriffen, Belästigungen und Beleidigungen von Journalist*innen. Kaum ein Fernsehteam besucht eine AfD-Demo noch ohne Sicherheitsdienst. Besonders gefährdet sind Lokalreporter*innen, die meist im gleichen Ort wie die Subjekte ihrer Berichterstattung leben.
Was tun?
- Pressefreiheit verteidigen: Eine unabhängige und plurale Presse gehört zur Demokratie. Angebrachte und wichtige Medienkritik sollte allerdings nicht zu unangebrachten Pauschalisierungen führen.
- Qualitätsjournalismus kultivieren und Medienvertrauen stärken: Sorgfaltspflicht bei der Recherche und Achtung der Menschenwürde (Pressekodex) sowie das Vermeiden von Diskriminierungen sozialer Gruppen sind vor allem in aufgeheizten Debatten und im Ringen um Aufmerksamkeit wichtiger denn je.
- Medienkompetenz fördern: Neben der Analyse von Zeitungsartikeln oder Videocontent sollte auch die Funktionsweise von Journalismus stärker erklärt werden: Wie funktioniert Nachrichtenjournalismus? Wie arbeiten Redaktionen? Welchen Auftrag haben Verlage? Diese Fragen sollten beispielsweise in den Schulunterricht und in die Lehramtsausbildung aufgenommen werden. Zudem ist ein kompetenter Umgang mit Suchinstrumenten im Internet oder die Quellenprüfung von Nachrichten in den Sozialen Medien eine wichtige Aufgabe für die politische Bildung.