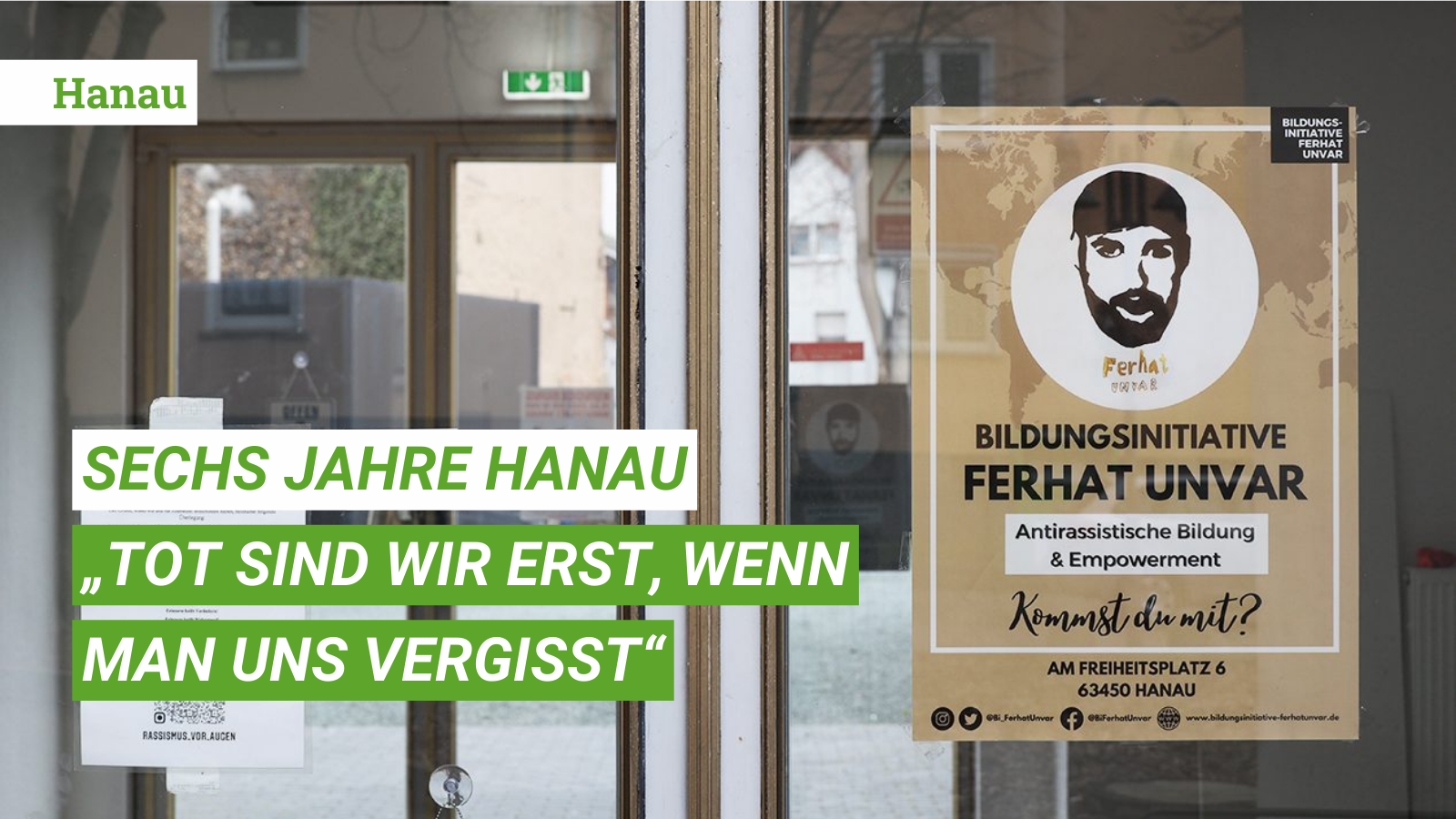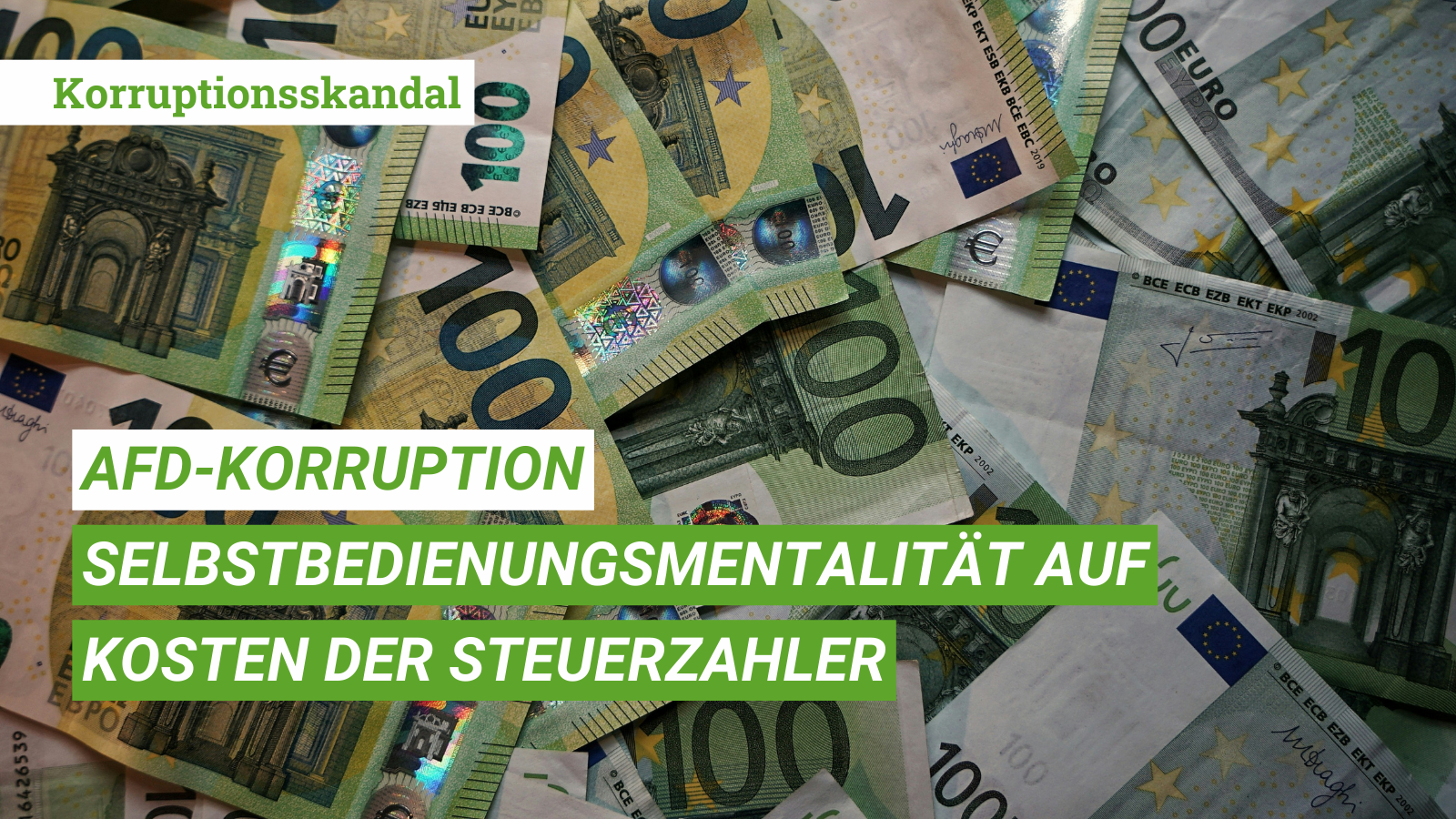Menschen in „wertvoll” und „nutzlos” einzuteilen, kann tödlich enden. Sozialdarwinismus gibt es in der Mitte der Gesellschaft genauso wie bei rechten Schlägern.
Von Merle Stöver
Im November 2000 ermordeten drei Neonazis in Greifswald Eckhard Rütz. Sie überfielen den obdachlosen 42-Jährigen an seinem Schlafplatz vor der Uni-Mensa und misshandelten ihn bewaffnet mit Baumstützpfählen. Er verstarb noch am Tatort. Die Tat begründete einer der Täter in einer Vernehmung damit, dass Eckhard Rütz „dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche gelegen“ hätte. Sie hätten ihm einen „Denkzettel“ verpassen wollen, meinte ein Mittäter.
Sozialdarwinismus ist eine der zentralen Säulen des Rechtsextremismus – doch wer ihn nur hier vermutet, irrt. Vorstellungen, dass die Gesellschaft sich um ein angebliches Recht des Stärkeren konstituiere oder dass manche nicht genug leisteten und dadurch eine Last, „nutzlos“ oder „minderwertig“ seien, sind sowohl gesellschaftlich als auch historisch auf einem breiten Kontinuum zu verorten.
Mit dem Satz „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ befürwortete 2006 etwa Franz Müntefering (SPD), seinerzeit Bundesminister für Arbeit und Soziales, das sogenannte Optimierungsgesetz der Hartz-IV-Reform und die darin vorgesehenen Kontrollbesuche bei Bezieher*innen des Arbeitslosengeldes. Eine ähnliche Schlagrichtung hatten einige Äußerungen während der Corona-Pandemie. So zweifelte die Publizistin Julia Löhr bereits im März 2020 die Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen an und fragte in der FAZ: „Rechtfertigt der Schutz einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, für die das Virus lebensbedrohlich ist, erhebliche Teile der Gesellschaft in wirtschaftliche Existenzängste zu stürzen?“
Bei aller Unterschiedlichkeit laufen die drei Beispiele auf die Grundprinzipien des Sozialdarwinismus hinaus. Dass den Genannten derartige Äußerungen und Forderungen offenbar leicht über die Lippen gehen, hat im Wesentlichen zwei Gründe: Einerseits sind derartige Positionen weit verbreitet und schlagen sich auch etwa in den Umfragen der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung nieder. Andererseits erfahren die Positionen zugleich nur wenig Tabuisierung und Gegenwehr. Diejenigen, die durch derartige Überzeugungen diskriminiert oder gar gefährdet werden, verfügen oft über keine Lobby, waren historisch Verfolgung ausgesetzt und erleben heute Marginalisierung, Ausschluss und Verdrängung.
Was ist Sozialdarwinismus?
Den Kern des Sozialdarwinismus als Ideologie und Überzeugung bilden die Annahmen, dass es in einer Gesellschaft Stärkere und Schwächere gebe und dass das Recht des Stärkeren gelte. Im Fokus steht dabei der vermeintliche (ökonomische) Nutzen von Menschen für die Gemeinschaft. Diese Wahrnehmung und Einteilung von Menschen in „wertvoll/nützlich“ und „wertlos/nutzlos“ äußert sich insbesondere in der Abwertung von Wohnungslosen, Sozialhilfeempfänger*innen, Langzeitarbeitslosen und Drogenkonsument*innen, aber auch in ableistischer Form von Menschen mit Behinderungen. Aus dieser Abwertung folgen im Sozialdarwinismus meist Maßnahmen und Gewalt gegen die Genannten.
Anders als es etwa Formen von Rassismus inhärent ist, werden Betroffene nicht als konkrete Bedrohung von außen oder als Feind*innen markiert, die es zu bekämpfen gelte. Sie werden in erster Linie als Last für die Gemeinschaft gesehen und daraus folgend als innere Gefahr. Sozialdarwinismus ist eine Ideologie, die nur im Zusammenhang mit der Vorstellung einer Gemeinschaft verstanden werden kann, wobei Gemeinschaft „Volk“, „Volkskörper“, „Volksgemeinschaft“, aber auch „Gesellschaft“ und „die Wirtschaft“ meinen kann. Das Individuum wird danach beurteilt, wie viel es angeblich für die Gemeinschaft leistet, wie „nützlich“ es ist oder ob es sie womöglich zurückhält oder gar verdirbt.
Militärischer Drill, Zwangsarbeit und Vernichtung
Sozialdarwinismus ist eine historisch gewachsene Ideologie und Praxis, deren Theoretisierung auf die Evolutionstheorie nach Charles Darwin (1809 – 1882) zurückgeht. Darwins Lehre, nach der sich die anpassungsfähigsten Tiere und Pflanzen durchsetzen, übertrug unter anderem Herbert Spencer (1820 – 1903) pseudowissenschaftlich auf das menschliche Zusammenleben. Diese Idee fand von Beginn an über alle politischen Lager hinweg zahlreiche Anhänger*innen.
Im Deutschen Kaiserreich galt zunächst beispielsweise die Arbeits- und Obdachlosigkeit insbesondere Alleinstehender als selbstverschuldete Konsequenz fehlender Arbeitsdisziplin und devianter Moralvorstellungen. Obwohl die Zuschreibungen sich unterschieden, Männer als „arbeitsscheue Vagabunden“ geschmäht und Frauen der Prostitution verdächtigt wurden, war in beiden Fällen die Annahme zentral, dass sie mit Zwang in die Gesellschaft reintegriert werden müssten. Mit den Arbeitshäusern entstand ein System aus Gewalt, Zwangsarbeit und des militärischen Drills, das der Disziplinierung der Menschen galt, die als deviant markiert wurden.
Zum Beginn des 20. Jahrhunderts gewannen schließlich eugenische Annahmen Einfluss, denen zufolge deviantes Verhalten auf pathologische Ursachen (etwa den pseudowissenschaftlich belegten „Wandertrieb“) zurückzuführen sei. Zwar wurde dadurch die Sinnhaftigkeit von Strafen hinterfragt, weil mit der Pathologisierung das Attestieren einer Schuldunfähigkeit einherging, doch wurden nun Forderungen nach Zwangsbewahrung und sogar -sterilisierung laut. Damit stellte sich in der Weimarer Republik in den 1920er Jahren der Kern sozialdarwinistischer Überzeugungen heraus: Personen sollten nicht nur aus der Gemeinschaft entfernt und weggesperrt werden, vielmehr sollte ihre Fortpflanzung verhindert werden. „Ausmerze“ galt als sozialrevolutionäre Idee, die eine gesundere, leistungsstärkere Gesellschaft hervorbringe und die das Leiden der Schwachen nicht unnötig verlängere.
Die Nationalsozialisten nahmen diese Vorarbeit nach der Machtübertragung 1933 dankbar auf. Als „asozial“ und „gemeinschaftsfremd“ galt, wer nicht den Normen der „Volksgemeinschaft“ entsprach. Diese wiederum stand als dem Führerprinzip untergeordnete Gemeinschaft der „deutschen Volksgenossen“ im Mittelpunkt der nationalsozialistischen Weltanschauung. Der Sozialdarwinismus der Nationalsozialisten zielte darauf, die „Volksgemeinschaft“ von denen zu befreien, die zu „Ballastexistenzen“ erklärt wurden. Auf der Grundlage verschiedener Gesetze und Erlässe wurden nun Menschen als „minderwertig“ und „erbkrank“ stigmatisiert, entmündigt, zwangssterilisiert und in Arbeitshäuser, Psychiatrien, Tötungsanstalten und Konzentrationslager verschleppt. Sie wurden gezielt und systematisch ermordet oder fielen der schweren Zwangsarbeit, Krankheiten und medizinischen Experimenten zum Opfer.
Die meisten Überlebenden erhielten keine Entschädigungen und stießen in beiden deutschen Nachfolgestaaten auf Verleugnung, Isolation und Ablehnung. Erst Ende der 1960er Jahre wurden in der BRD die Arbeitshäuser geschlossen und die Zwangsunterbringung von „Gefährdeten“ verworfen. Die DDR schuf mit dem sogenannten „Asozialenparagrafen“ (§ 249 StGB DDR) ein strenges Instrument der Sozialdisziplinierung. Bis zur Wiedervereinigung blieben die Zahlen derer, die auf dieser Grundlage zu Haft und Arbeitserziehung verurteilt wurden, konstant hoch.
Erst 2020 erkannte der Deutsche Bundestag die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ Verfolgten als Opfer des Nationalsozialismus an. Die Opfer der nationalsozialistischen Krankenmorde („Euthanasie“) und der Zwangssterilisationen wurden sogar erst 2025 explizit anerkannt. Die meisten Entschädigungsberechtigten waren zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben. Die AfD enthielt sich als einzige Fraktion bei der Abstimmung im Januar 2020 und begründete dies mit der fadenscheinigen Behauptung, dass unter denen, die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ verfolgt wurden, Kriminelle gewesen seien, die demnach nicht pauschal zu Opfern des Nationalsozialismus erklärt werden könnten.
Worte und Taten der Rechtsextremen
Im Sozialdarwinismus der extremen Rechten verbinden sich zwei Elemente miteinander: So basiert er einerseits auf der Relativierung oder Glorifizierung der nationalsozialistischen Verbrechen und Täter sowie der Verhöhnung der Opfer. Andererseits gilt ihm die bereits beschriebene antiegalitaristische Überzeugung als Grundpfeiler, nach der Menschen von Natur aus unterschiedlich seien und es sich dabei um eine naturgegebene Hierarchie handele. Soziale Ungleichheiten folgten demnach vermeintlich nicht aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern aus einer unveränderbaren Ungleichwertigkeit. Daraus folgt die Ablehnung jedes gesellschaftlichen Solidarsystems, wie 2007 eine Plenarrede des damaligen Fraktionsvorsitzenden der NPD (heute Die Heimat) in Mecklenburg-Vorpommern, Udo Pastörs, deutlich machte. Pastörs sagte: „Unser erstes Augenmerk hat dem Gesunden und Starken zu gelten. Dieses ist zuallererst zu fördern und zu unterstützen. Das ist keine Selektion, sondern einfache Logik.“
Die AfD übersetzt das sozialdarwinistische Grundprinzip in konkrete Forderungen: Sie wirbt für die Verpflichtung von Bürgergeld-Empfänger*innen zu gemeinnütziger Arbeit. Sollten diese dem nicht nachkommen, fordert die AfD, zunächst lediglich Sachleistungen und schließlich gar keine Leistungen mehr auszugeben. Dass sich auch die Position zu Inklusionspolitik hier einfügt, belegen Äußerungen Björn Höckes. Der Thüringer AfD-Vorsitzende diffamierte im MDR-Sommerinterview 2023 inklusive Beschulung von Schüler*innen mit und ohne Behinderungen als „Ideologieprojekt“ und „Belastungsfaktor“, der Schüler*innen nicht leistungsfähiger mache und von dem das Bildungssystem befreit werden müsste. An anderer Stelle verbinden Rechtsextreme Sozialdarwinismus zudem oft mit Rassismus und Antiziganismus. Dies mündet in Einwanderungsdebatten in der Hetze gegen vermeintliche „Sozialschmarotzer“ und in Forderungen nach der Abschaffung des Asylrechts oder der EU-Freizügigkeit.
Rechtsextreme setzen diese Einstellungen und Überzeugungen oft in die Tat um. Die Vorstellung eines homogenen Volkes ohne Abweichungen und des Rechtes der Stärkeren dient ihnen als Motivation für Einschüchterung, Gewalt und sogar Mord: Mindestens 23 Menschen wurden seit 1990 aus sozialdarwinistischen Motiven getötet – weil sie wie Horst Pulter obdachlos waren, weil sie wie Dieter Eich Sozialhilfeempfänger*innen waren oder aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Behinderungen wie im Fall von Jörg Danek. Die Zahl der Fälle, die nicht staatlich anerkannt wurden, denen aber von zivilgesellschaftlicher Seite sozialdarwinistische Motive nachgewiesen wurden, ist wesentlich höher.
In der Mitte
An dieser Stelle ist die Brücke erneut zur „Mitte“ der Gesellschaft zu schlagen: Denn insbesondere sozialdarwinistisch motivierte Taten werden oftmals entpolitisiert, nicht als rechte Gewalt anerkannt und geraten schnell in Vergessenheit. Meist findet weder eine Auseinandersetzung mit den Tatmotiven noch mit Maßnahmen statt, die die betroffenen Menschen effektiv vor Hassverbrechen schützen würden. Stattdessen begegnen viele den Opfern mit Gleichgültigkeit.
In den repräsentativen Umfragen der Mitte-Studie 2022/2023 stimmten der Aussage, dass bettelnde Obdachlose aus den Fußgängerzonen entfernt werden sollten, 19,8 Prozent mindestens „eher“ und weitere 22,4 Prozent „teils“ zu. Sogar 34,8 Prozent waren mindestens „eher“ und weitere 31,2 Prozent zumindest „teils“ der Meinung, dass Langzeitarbeitslose sich auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machten. Diese Zustimmungswerte weisen zum einen auf feindliche Einstellungen gegenüber den Genannten hin, zum anderen impliziert erstere Aussage sogar einen Handlungsaufruf, der von kommunalen Verwaltungen, Polizei und Sicherheitsdiensten an vielen Orten auch in die Tat umgesetzt wird.
Die eingangs genannten Beispiele – der Mord an Eckhard Rütz, die Äußerung Münteferings und die Prioritätensetzung während der Pandemie – zeigen die Flexibilität dessen, welche Konsequenzen ideologisch für die angeblich Schwächeren veispielorgesehen sind: Sie variieren zwischen Sanktionierung und Disziplinierung auf der einen und Vernichtung und Mord auf der anderen Seite. Lucius Teidelbaum spricht hier von einem manifesten Sozialdarwinismus, der die Überzeugungen und Handlungen der Rechtsextremen meint, und einem latenten Sozialdarwinismus, der sich in Einstellungen und ihrer Übersetzung in Leistungskürzungen oder Platzverweisen zeige. Gemein ist beidem jedoch eines: Dass die Würde eines Menschen von seiner Leistung abhänge.
Der Artikel erschien ursprünglich bei Belltower.News.