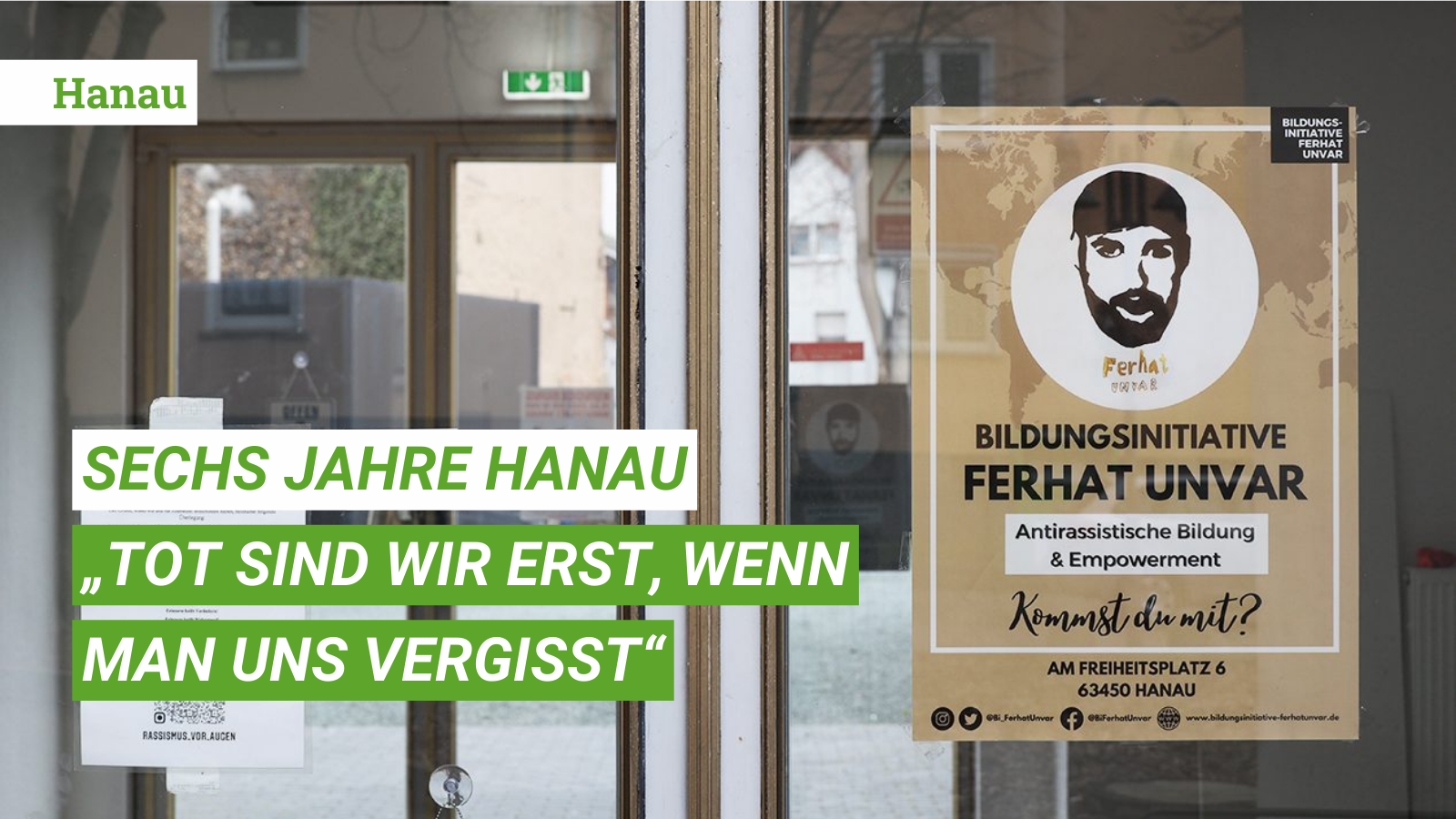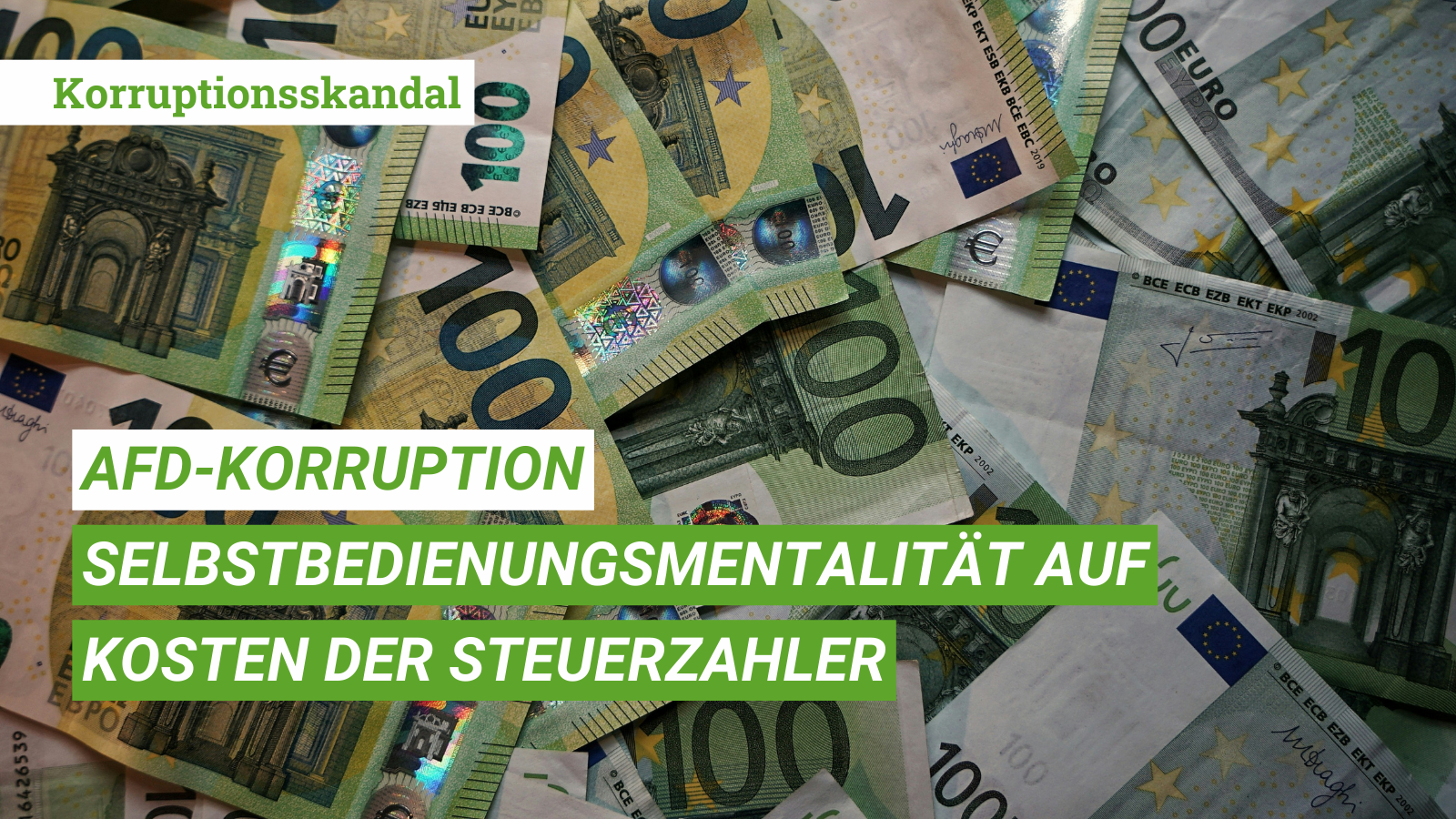Politische Gewalt hat ihre eigene Aufmerksamkeitslogik. Der Mord an Charlie Kirk machte einen bis dahin in Deutschland weitgehend unbekannten rechtsextremen Kulturkämpfer über Nacht zum weltweiten Topthema, während zentrale Kontexte ausgeblendet blieben.
Von Una Titz
Am 10. September 2025 sprach Charlie Kirk an der Utah Valley University in Orem. Während der Fragerunde kam es zu einer Diskussion über transfeindliche Gewaltstatistiken. Noch während Kirk antwortete, fiel ein Schuss. Sekunden später lag der Gründer von „Turning Point USA“ tödlich getroffen am Boden. Das Attentat wurde binnen Minuten ein globales Medienereignis.
Attentate als mediale Aufmerksamkeitsökonomien
Der Mord an Charlie Kirk dominierte Schlagzeilen in Ländern, in denen zuvor kaum jemand wusste, wer Kirk überhaupt war. Ob in Deutschland oder Frankreich – die Google-Trend-Kurven verdeutlichen, wie sehr dieses Ereignis die digitale Aufmerksamkeitsökonomie gefangen nahm. In Deutschland etwa überstieg das Suchinteresse nach „Charlie Kirk“ die Spitzen zu den Landtagswahlergebnissen in Nordrhein-Westfalen, zum Basketball-EM-Finale und sogar zu den blutigen Protesten in Nepal.
Wer war Charlie Kirk?
Wer Charlie Kirk war, lässt sich am deutlichsten aus seinen eigenen Worten ablesen. Immer wieder warnte er in seiner Sendung The Charlie Kirk Show oder auf großer Bühne vor dem sogenannten „Great Replacement“, etwa: „Die große Ersetzungsstrategie, die sich Tag für Tag an unserer Südgrenze vollzieht, ist eine Strategie, das weiße ländliche Amerika durch etwas anderes zu ersetzen.“ Mit diesem Begriff, im Deutschen als „großer Austausch“ bekannt, wird die wahnhafte Vorstellung beschrieben, es gebe eine gezielte Strategie einflussreicher Eliten, die weiße Bevölkerung durch Zuwanderung zu ersetzen. Die Formel entstammt ursprünglich rechtsextremen Diskursen in Europa und fand über Figuren wie Kirk Eingang in die US-amerikanische Debatte.
Auch seine Haltung zur Migration insgesamt war unmissverständlich, zumal er immer wieder auf historische Phasen strikter Zuwanderungsbegrenzung verwies: „Amerika befand sich auf dem Höhepunkt, als wir die Einwanderung für 40 Jahre gestoppt und den Ausländeranteil auf das niedrigste Niveau aller Zeiten gesenkt haben. Wir sollten keine Angst haben, das wieder zu tun.“ Solche Sätze verschränkt er mit offenen Schuldzuweisungen, die antisemitische Chiffren verwenden: „Jüdische Spender waren der wichtigste Finanzierungsmechanismus für radikale Politik der offenen Grenzen, für neoliberale, quasi-marxistische Programme, für kulturelle Institutionen und Nonprofits. Dieses Ungeheuer wurde von säkularen Juden erschaffen (…).“ In einer weiteren Rede betonte er: „Juden gehörten in den letzten dreißig oder vierzig Jahren zu den größten Geldgebern für kulturell-marxistische Ideen und Unterstützer dieser Ideen.“
Damit knüpfte Kirk an eine alte antisemitische Erzählung an: die Vorstellung eines „jüdischen Einflusses“ auf Politik, Kultur und Wirtschaft. Der Begriff „Kulturmarxismus“ dient dabei als rechtsextreme Dogwhistle. Er beschwört eine vermeintliche Elite, die Universitäten, Medien und Institutionen kontrolliere, um die Gesellschaft zu unterwandern. Wenn Kirk von „cultural Marxist ideas“ sprach, war das daher mehr als Polemik gegen linke Konzepte, es war ein Signal, das in extrem rechten Milieus verstanden wurde: Die Anspielung auf eine geheime, jüdisch dominierte Macht, die den gesellschaftlichen Wandel lenke.
Kirk behauptete auch, dass Schwarze Frauen, wie Michelle Obama, Jobs oder Positionen nur aufgrund von „Affirmative Action“ – also positiven Maßnahmen, die auf eine tatsächliche und vollständige Chancengleichheit abzielen – erhielten: „Sie verfügen nicht über die geistige Verarbeitungsfähigkeit, um wirklich ernst genommen zu werden. Sie mussten einem Weißen seinen Platz wegnehmen, um einigermaßen ernst genommen zu werden.“
All diese Zitate und viele noch explizitere liegen offen vor, dokumentiert und vielfach belegt. Umso bemerkenswerter ist es, dass sie in der deutschen Berichterstattung bislang keine Rolle spielten – ein entscheidendes Detail, wenn hierzulande die Presse dubiose Vergleiche zwischen Kirk und Martin Luther King Jr. bemüht. Grundsätzlich sollte gelten: Man muss das politische Wirken Kirks nicht verharmlosen, um politische Gewalt zu verurteilen. In der Eile, Kirk medial für die breite Öffentlichkeit zu übersetzen, sind ehrliche Darstellungen seiner Äußerungen in Deutschland vielfach völlig ausgeklammert worden.
Quo vadis Berichterstattung?
Bemerkenswert ist, wie deutsche Leitmedien das Ereignis rahmten. Denn es blieb keineswegs bei einer bloßen Tathergangsbeschreibung, vielmehr wurden zentrale Kontexte ausgespart, Nebenschauplätze eröffnet und teils maßlose Vergleiche bemüht. Ein Beispiel: Die Tagesschau bezeichnete Kirk als „Podcaster, der für konservative Werte warb“, eine grobe Untertreibung und zugleich eine Fehlzuschreibung von Konservatismus.
Kirks jahrzehntelanger Diskurs zielte nicht auf die Bewahrung konservativer Traditionen, sondern auf die offene Attacke gegen Minderheiten, gegen BiPOCs, Jüdinnen*Juden, Menschen mit Migrationshintergrund und LGBTQ-Personen. Statt seine Sprechakte und ideologischen Strategien sichtbar zu machen, reduzierte die Berichterstattung ihn auf das harmlose Etikett des „konservativen Aktivisten“ – Einordnung über Auslassung.
Bild hingegen wählte eine andere Inszenierung und bettete den Fall in die Dramaturgie eines True-Crime-Spektakels ein, zeichnete Kirk gar indirekt als eine Art kontroversen „Brückenbauer“. In einem weiteren Bild–Kommentar wurde sein Tod schließlich in eine pathetische Erzählung vom Anschlag auf die Meinungsfreiheit eingeordnet, die Kirk in eine Reihe mit Martin Luther King oder JFK stellte: „Auch, wenn ihn in Deutschland bis vor kurzem kaum jemand kannte: Der Mord an dem 31-jährigen Familienvater wird sich in die Liste historischer US-Attentate einreihen, neben JFK, Martin Luther King und Bobby Kennedy.“
Damit verschob die Berichterstattung eklatant den Fokus. Anstatt Kirks Ideologie und seine Rolle im amerikanischen Kulturkampf offenzulegen, wurde er wahlweise auf „konservativ“ reduziert, zum Opfer eines vermeintlichen Angriffs auf die Meinungsfreiheit stilisiert oder gar zum Aufhänger für eine Debatte über linken Spott gemacht.
Genau dieser Mechanismus treibt den Kulturkampf weiter an: Wichtige Kontexte fehlen, während Nebenschauplätze dramatisiert werden. Und darin liegt das strukturelle Problem: Digitale MAGA-Kulturkämpfe aus den USA schlagen in Echtzeit in deutsche Timelines durch, unabhängig davon, ob hiesige Leser*innen überhaupt wissen, wer die entsprechenden Personen sind und wofür sie stehen.
Der Artikel erschien ursprünglich bei Belltower.News.