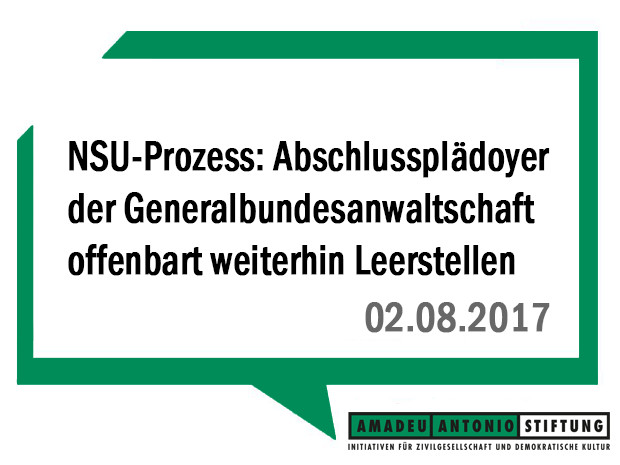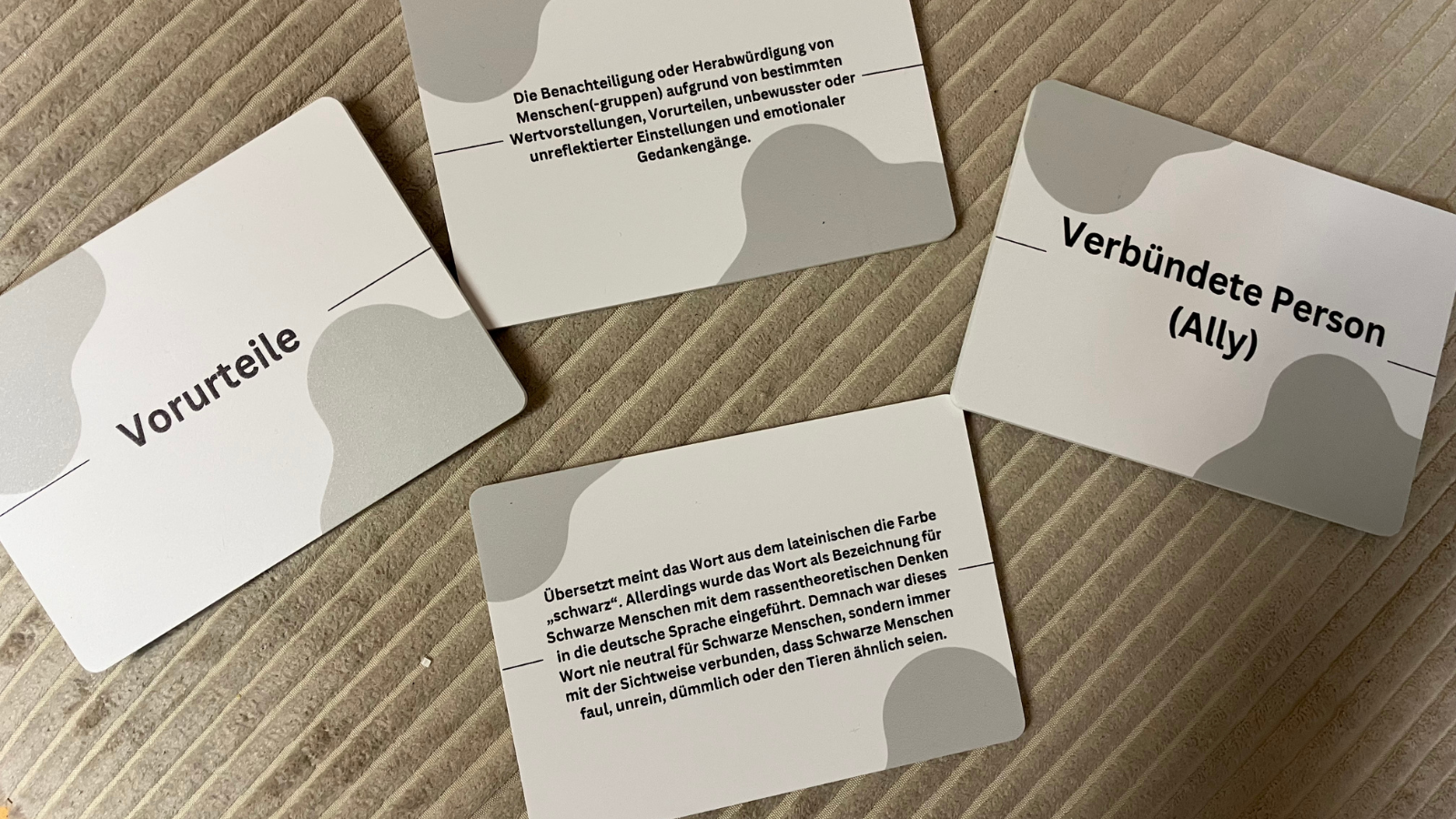Das Abschlussplädoyer der Generalbundesanwaltschaft im NSU-Prozess offenbart Leerstellen in den Ermittlungen rund um die rechtsterroristischen Verbrechen. Problematisch und unbefriedigend bleibt, dass die Generalbundesanwaltschaft weiterhin von einem NSU-Trio ausgeht, welches nur von den Mitangeklagten unterstützt wurde. Dabei werden weder die rechtsextremen Strukturen und Gruppen, innerhalb denen sich die drei bewegten, noch die Personen, mit denen sie zusammen arbeiteten, in einen Zusammenhang gestellt.
„Gegen die Trio-Theorie sprechen auch die aktiven Frauen rund um die Angeklagten. Beispielsweise waren Mandy S. und Antje Probst erwiesenermaßen bzw. mutmaßliche Unterstützerinnen des NSU und innerhalb der rechtsextremen Szene bekannt. Im Prozess und in den Untersuchungsausschüssen gab es immer wieder deutliche Hinweise darauf, dass Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt Unterstützung von weiteren Personen an den Tatorten erhalten haben müssen“, erklärt Judith Rahner, Leiterin der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus der Amadeu Antonio Stiftung. “Die wiederholte Forderung von Betroffenen und Opferangehörigen, diese Hintergründe zu beleuchten, wurde leider ignoriert.“
Dass Ermittlungsfehler durch Geschlechterstereotype und die Verharmlosung der Rolle von Frauen in der Szene geschahen, zeigt beispielsweise eine Rasterfahndung 2007 im Raum Nürnberg. Hier wurden alle Frauen von einer Liste des Verfassungsschutzes gestrichen, die Namen von Neonazis aufführte. Damit wurde auch Mandy S. von der Liste gestrichen, eine schon frühe Unterstützerin des NSU. Auch staatliche Ermittlungen und Verwicklungen werden durch die Generalbundesanwaltschaft nicht thematisiert und problematisiert. Unbenannt bleibt damit der institutionelle Rassismus, den die Opferangehörigen und Betroffenen nach den Taten erfahren mussten.
„Wenn politische Überzeugungen, die Rolle von rechtsextremen Frauen und Netzwerken in der juristischen Aufarbeitung unzureichend berücksichtigt werden, werden auch rechtsextreme Gewalt und Rechtsterrorismus als gesellschaftliches Problem weniger wahrgenommen“, führt Rahner aus. „Die im Prozess vertretenen Betroffenen und Angehörigen werden durch solche Annahmen nicht ernst genommen und diffamiert. Ihr Wunsch nach vollständiger Aufklärung des NSU und seiner Unterstützungsnetzwerke wird nicht eingelöst.“
Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen Stellungnahme der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus der Amadeu Antonio Stiftung unter dem Link unten.