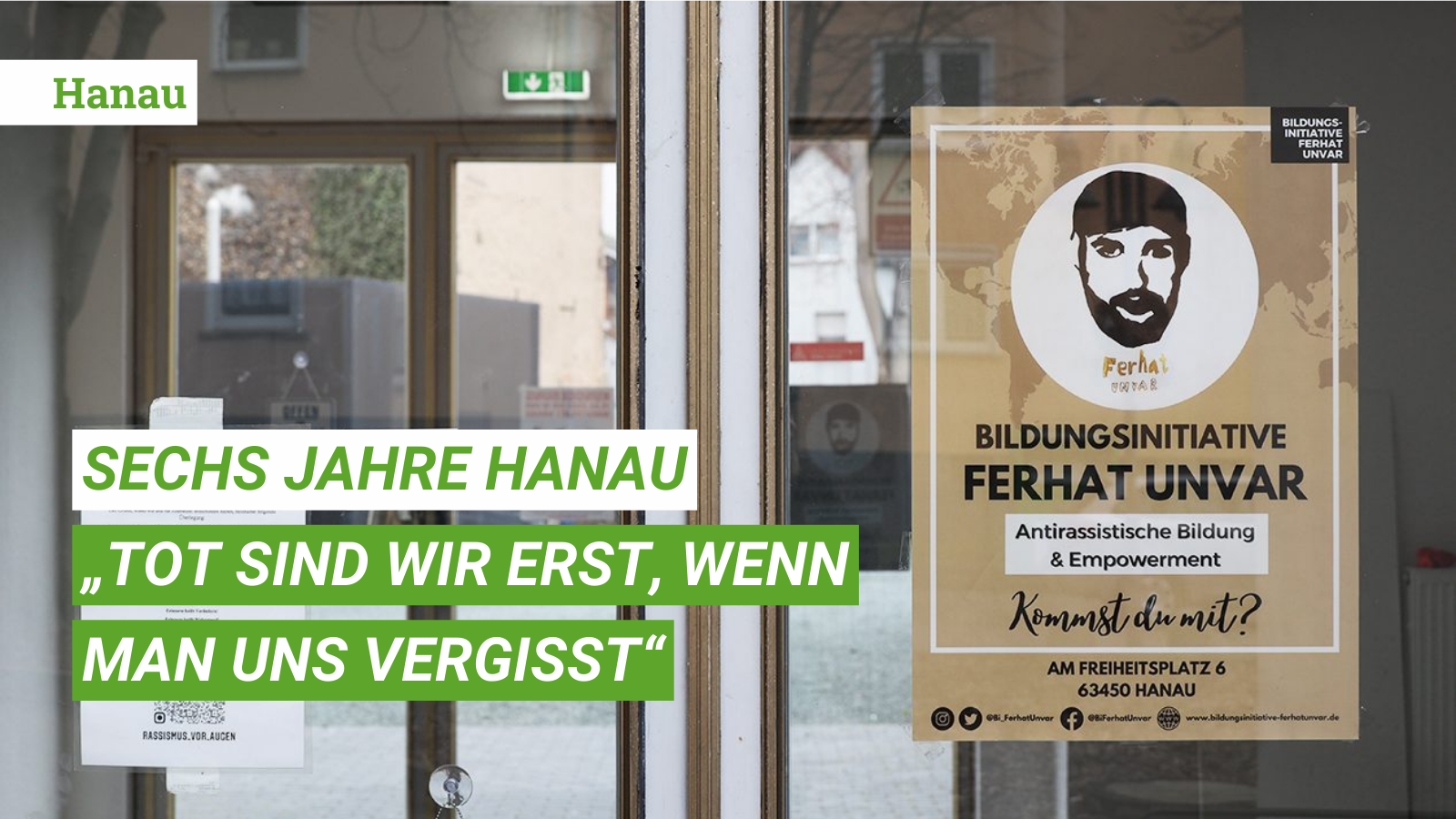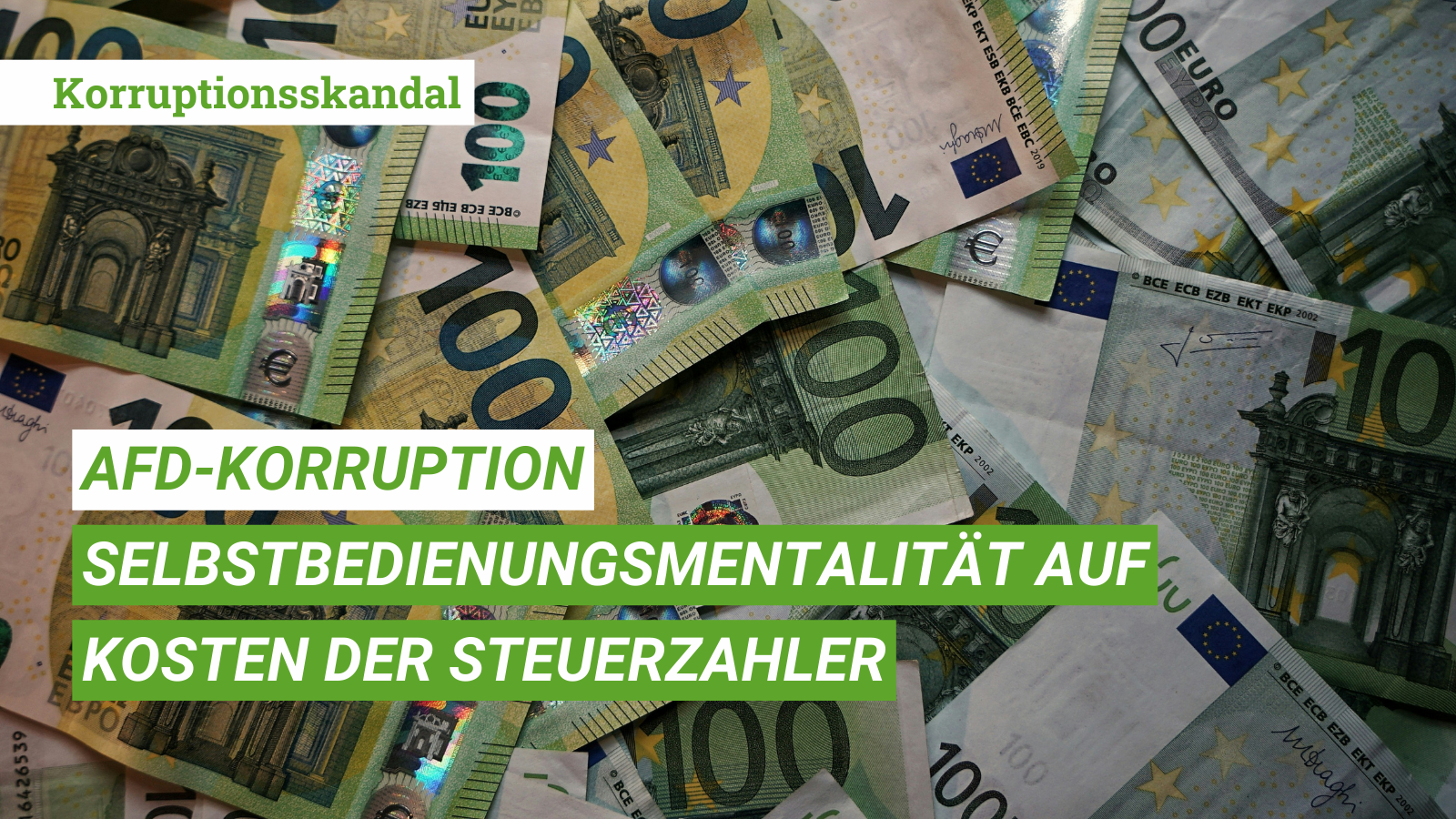Sie sind jung, radikal und extrem gewaltbereit: Am 21. Mai 2025 wurden in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen 13 Wohnungen von mutmaßlichen Rechtsterroristen durchsucht, die sich als „Letzte Verteidigungswelle“ organisiert haben. Fünf Personen wurden festgenommen, gegen sie wurden Haftbefehle erlassen.
Ben-Maxim H., Lenny M., Benjamin H., Jerome M. und Jason R. sind Teil einer neuen rechtsextremen Jugendkultur, die sich Rechtsterroristen wie Anders Breivik und Beate Zschäpe zum Vorbild nimmt. Selbst ermächtigt, enthemmt und bestätigt durch AfD-Wahlergebnisse will die Gruppe die „Deutsche Nation“ verteidigen. Die Mitglieder der „Letzten Verteidigungswelle“ sind auffallend jung und extrem gewalttätig. Die Gruppe existiert mindestens seit April 2024, zum Zeitpunkt der Gründung waren alle fünf Festgenommenen noch minderjährig.
„Ihr Ziel ist es, durch Gewalttaten vornehmlich gegen Migranten und politische Gegner einen Zusammenbruch des demokratischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen“, erklärt die Bundesanwaltschaft.
Anschläge gegen selbsterklärte „Volksfeinde“
Um dieses Ziel zu erreichen, schrecken die Mitglieder der „Letzten Verteidigungswelle“ auch vor roher Gewalt nicht zurück. In Altdöbern zündeten in der Nacht des 23. Oktober 2024 zwei beschuldigte 15-Jährige ein Kulturhaus an, das sie fälschlicherweise für einen Szene-Treffpunkt von Linken gehalten haben sollen. In Schmölln schlugen sie im Januar 2025 die Scheiben einer bewohnten Geflüchtetenunterkunft ein und versuchten Brandsätze aus Pyrotechnik ins Innere zu werfen. Am Tatort hinterließen sie Hakenkreuze und andere rassistische Parolen. In Senftenberg konnte im Februar 2025 ein Sprengstoffanschlag auf eine bewohnte Geflüchtetenunterkunft dank der Hinweise einer Journalistin nur knapp verhindert werden.
Auch weitere Planungen von Brand- und Sprengstoffanschlägen auf Asylbewerberheime und Einrichtungen selbsterklärter „politischer Gegner“ werden ihnen vorgeworfen. Mit den Taten sollen Botschaften kommuniziert werden, es geht um Verunsicherung und Angst. Kurzum: rechten Terror.
Wie gewalttätiger Rechtsextremismus wieder angesagte Jugendkultur wird
Rechtsextreme Angriffe nehmen rasant zu. Zur Zielscheibe wurden zuletzt Jugendclubs, CSDs und eine demokratische Zivilgesellschaft, die gegen Rechtsextreme auf die Straße geht. Jugendliche sind nicht nur vermehrt unter den Betroffenen, sondern auch unter den Gewalttätern.
Im Juli 2024 wurde in Berlin eine Gruppe auf dem Weg zu einer Demo gegen Rechts von 15 vermummten Neonazis mit Schlagstöcken und Reizgas brutal angegriffen wurde. Die Opfer waren im Alter zwischen 15 und 39 Jahren, viele der Angreifenden waren auffällig jung. Nur wenige Wochen setzte die Polizei eine offenbar gewaltbereite 28-köpfige Gruppe fest, die mit Zahnschutz und Lederhandschuhen ausgerüstet waren und wohl Angriffe auf den CSD planten. Von den 28 in Gewahrsam genommenen war die Hälfte minderjährig.
„Man sieht hier öfter so Kinder-Nazis, also Jugendliche mit Springerstiefeln, Bomberjacken und Glatzen rumlaufen. Ist schon auffällig in letzter Zeit“, beschreibt ein Bewohner die Situation in Grevesmühlen, wo es im Juni 2024 zu einem rechtsextremen Übergriff auf zwei ghanaische Mädchen kam.
In Videos von dem Angriff bestätigt sich das Bild: Die Täter erscheinen im altbekannten Stil und erinnern an die Neonaziszene der 1990er. Ein Sozialarbeiter aus Grevesmühlen sagt dazu: „Es kommt mir vor wie eine Modeerscheinung, als wäre es eine Jugendkultur, wie früher Hip-Hop, Rap oder Punk“.
Rechtsextrem sein als Mainstream – die Haltestelle der Identitätssuche: „Rassist“, wie sich ein Jugendlicher aus Grevesmühlen sogar selbst beschreibt.
Warum das funktioniert
Am Beispiel von Grevesmühlen wird das Dilemma der Jugendlichen deutlich: Sie wollen dazugehören – und die am besten vernetzte Peer Group ist rechtsextrem.
Auf der Suche nach Anschluss und gesteuert von Unsicherheiten darüber, wer man ist und vor allem wer man sein möchte, treffen Jugendliche auf Gruppen, die starke Meinungen und einfache Antworten haben. Stärke und Gemeinschaftsgefühl als Magnet für Jugendliche.
Die Spielregeln sind einfach: Zur Begrüßung gibt es Nazi-Parolen wie „Sieg Heil“, oder „Heil Hitler“, eventuell noch den Hitlergruß und danach hetzt man gemeinsam über und gegen „Ausländer“, wie ein Jugendlicher aus der rechtsextremen Szene von Grevesmühlen berichtet.
Rechtsextreme Gruppierungen wie die sogenannte „Letzte Verteidigungswelle“ bieten solchen Jugendlichen Orientierung und ein Gefühl von Identität. Sie arbeiten mit klaren Feindbildern – etwa gegen Migranten, Politikerinnen, Linke oder queere Menschen. Die Gruppen fördern ein starkes Gemeinschaftsgefühl und animieren zu gewalttätigem Verhalten. Innerhalb dieser Strukturen wird Gewalt als Heldentat gefeiert, während die persönliche Verantwortung hinter rechtsextremen Ideologien verschwindet.
Rechtsextreme Online-Mobilisierung
Die rechtsextreme Szene agiert im Internet ganz öffentlich und trotzdem weitgehend unbeachtet. Völlig ungeniert treten Profile im Netz auf: Teilweise mit rechtsextremen Codes und Symbolen, die nur Eingeweihte verstehen, sogenannte „Dogwhistles“, teilweise aber auch ganz offen.
Hinter dieser Form der menschenfeindlichen digitalen Mobilisierung stecken nicht allein rechtsextreme Einzelprofile. Es sind Netzwerke, Fake Accounts rechtsextremer Gruppen der Identitären Bewegung, der rechtsextremen Kleinstpartei „III. Weg“ oder der „Jungen Alternative“, die sich online vernetzen. Mit ihrer neu gegründeten Jugendgruppe „Deutsche Jugend Voran“ konnte allein der „III. Weg“ innerhalb weniger Posts mehr als 2.000 Abonnent*innen bei Instagram sammeln.
Was tun?
Der Schlüssel ist und bleibt politische und demokratiefördernde Bildung. Sie braucht aber mehr Geld und Ressourcen. Die (Jugend-)Sozialarbeit muss ausgebaut werden, auch um digitale Angebote, wie Digital Streetwork. Denn Jugendsozialarbeit ist Demokratiearbeit.
Nicht-rechte Jugendliche brauchen sichere Räume, um sich zu treffen und zu vernetzen. Die wenigen Jugendclubs, die es noch gibt, müssen dringend besser geschützt werden. Was auch bedeutet, dass die Sicherheitsbehörden die rechtsextreme Strategie ernst nehmen müssen und nicht als Auseinandersetzung unter Jugendlichen abtun dürfen.