Auf unserer Fachtagung „Zwischen Misstrauen und Demokratiegefährdung: Wie arbeiten gegen Verschwörungsideologien?“ im März in Leipzig gab Jan-Gerrit Keil, Psychologe beim Staatsschutz in Brandenburg, einen Workshop zum Einfluss von Verschwörungsdenken auf Radikalisierungsprozesse bei Straftäter*innen, der von ihm auch im kostenfrei bestellbaren Fachtagungs-Band nochmal erläutert wird.
Hier befragte Projektleitung Benjamin Winkler ihn nun noch einmal zu seinen Einschätzungen konkreter Anlässe:
Vor Kurzem wurde die neue Kriminalstatistik für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die sogenannte politisch motivierte Kriminalität (PMK) stieg erneut stark an. Gibt es Erkenntnisse, dass Verschwörungsdenken hierzu beiträgt?
Jan-Gerrit Keil: Ich würde die Frage gerne mit einem klaren Ja oder Nein beantworten, aber das ist nicht möglich. Zunächst einmal kann ich natürlich nur für die PMK-Zahlen in Brandenburg sprechen. Hier sind die Zahlen zum Vorjahr noch einmal angestiegen, und in absoluten Zahlen fallen die größten Zuwächse auf die Bereiche der Straftaten „PMK rechts“ mit insgesamt 53,2 % aller PMK-Straftaten und „PMK Sonstige Zuordnung“ mit 26,6 % aller Straftaten.
Ein Großteil aller Straftaten, nämlich 1.877 von 6.813 Straftaten gesamt im Jahr 2024, sind dabei auf Straftaten im Zusammenhang mit Wahlen zurückzuführen. Auch aus vorherigen Jahren ist bekannt, dass Wahlen immer zu einem Anstieg von Straftaten – vor allem der Propagandadelikte, aber auch Hasspostings und Sachbeschädigungen von Wahlplakaten – führen. Dieser Anstieg durch Wahlen betrifft alle Formen politisch motivierter Kriminalität, er ist aber absolut gesehen in Brandenburg im Bereich „PMK rechts“ am größten.
Einen direkten Einfluss des Verschwörungsdenkens auf den Anstieg zu messen, ist mit polizeilichen Zahlen nicht möglich, da sich Verschwörungsdenken als Meta-Konstrukt hinter sehr vielen Themenfeldern der PMK ursächlich verstecken kann. So können sich hinter antisemitischen und rassistischen Straftaten verschwörungstheoretische Annahmen wie die vom „Great Reset“ oder „White Genocide“ verbergen. Elitenfeindliche Einstellungen und das „Reichsbürger“-Narrativ können die Ursache für Angriffe auf Amtspersonen und Mandatsträger sein, das „INCEL“-Narrativ kann zu Angriffen auf Frauen und LGBTQ+-Personen führen, und das Narrativ von den „gestohlenen oder manipulierten Wahlen“ kann zu Straftaten im Zusammenhang mit dem Wahlgeschehen motivieren.
Verschwörungsdenken stellt somit ein Meta-Konstrukt dar, das auf sehr viele Felder der PMK einzahlen kann, ohne dass dieser Einfluss explizit auf den ersten Blick im Sinne einer offenen Plakatierung immer erkennbar wäre. Am ehesten ist der Zuwachs mit dem Zusammenhang der Wahlen und den dadurch ausgelösten Diskursen insgesamt in Verbindung zu bringen.
Der Attentäter von Magdeburg, der am 20. Dezember 2024 mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt der Domstadt raste, um dort Menschen zu töten, scheint durch Verschwörungsideologien beeinflusst gewesen zu sein. Inwiefern verleitet Verschwörungsdenken Menschen dazu, terroristische Taten zu verüben?
Jan-Gerrit Keil: Eine biografische Analyse des Täters und die genaue Tathergangsanalyse der Tat von Magdeburg wird noch zu machen sein. Solche Taten sind nie monokausal, sondern immer nur durch ein Motivbündel und ein Zusammenwirken von Person und Situation erklärbar. Aus der Vergangenheit wissen wir aber, dass sich Attentäter in ihren Manifesten und Bekennervideos zur ideologischen Begründung ihrer Taten explizit auf diverse Verschwörungstheorien beziehen. Neben der ideologischen Ebene müssen bei der Betrachtung von verschwörungstheoretischem Denken aber noch weitere psychologische Effekte in den Blick genommen werden, die zur Radikalisierung beitragen können. Diese Effekte sind im Einzelnen in einer verzerrten Wahrnehmung der Welt und einer durch die Algorithmen gesteuerten selektiven Informationsaufnahmen durch die sogenannten „alternativen Medien“ zu finden. Dies führt zu einer Verkennung von Fakten und in der Folge zu einer falschen Risikowahrnehmung in Bezug auf die eigene Lage und Person.
Wir wissen aus der Wissenschaft, dass Verschwörungsgläubige zu einer apokalyptischen Weltsicht tendieren. Sie leben gefühlt in einer absolut feindlichen Welt, in der sie niemandem mehr trauen können. Sie verfallen durch die Erzählungen in dichotome Denkmuster – es gibt nur noch Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Freund und Feind. Für jeden Missstand wird ein Schuldiger benannt, und alternative, komplexe Erklärungen für die Realität werden abgelehnt. So wird einerseits die Angst ständig gesteigert, und andererseits der Hass auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und Minderheiten geschürt. Erfährt diese eingeengte, apokalyptische Weltsicht kein Korrektiv mehr, können Angst und Hass gegenüber den zum Sündenbock erklärten Bevölkerungsgruppen am Ende in gewalttätige Handlungen umschlagen, die aus vermeintlicher Notwehr heraus begangen werden.
Was würden Sie als Polizeipsychologe bzgl. der Ausgestaltung von Präventionsmaßnahmen zum Verschwörungsdenken sagen – was kann dazu beitragen, dass sich Menschen weniger schnell und stark durch Verschwörungsideologien radikalisieren?
Jan-Gerrit Keil: Tatsächlich befasse ich mich als Kriminalpsychologe beim LKA überwiegend mit der Strafverfolgung bereits begangener und der Gefahrenabwehr unmittelbar bevorstehender Straftaten. Es ist somit ein täterzentriertes Vorgehen, bei dem klar der Schutz der Bevölkerung im Mittelpunkt steht. Meine Aufgabe liegt nicht in der Kriminaltherapie der Täter, sondern darin, die Polizei Brandenburg in die Lage zu versetzen, Täter möglichst schnell dingfest zu machen. Eine effektive Polizeiarbeit wirkt im besten Fall dann auch abschreckend auf zukünftige Täter und zeigt die staatlich definierten Grenzen auf, über die ein Täter nicht gehen sollte.
Prävention insgesamt ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss von allen Akteuren geleistet werden – sie kann niemals nur Aufgabe der Polizei allein sein. Aus der Forschung wissen wir, dass im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien „Prebunking“ wirksamer ist als „Debunking“. Das heißt: Wer erst einmal tief im Kaninchenbau drinnen ist, den holt so schnell keiner mehr da raus. Für diese Fälle ist die Arbeit mit Angehörigen oft effektiver als die Arbeit mit den Verschwörungsgläubigen selbst. Damit die Leute gar nicht erst in den Strudel der Verschwörungstheorien hineinfallen, kann es dagegen hilfreich sein, bereits im Vorfeld über die Methoden und Mechanismen von Verschwörungserzählungen sowie die gängigsten Narrative aufzuklären. Dadurch sind die Betroffenen gegen diese Erzählungen und Strategien sozusagen immun und fallen nicht mehr auf sie herein.
Diese Aufklärungsarbeit kann nicht nur von der Polizei geleistet werden. Sie sollte an Schulen für Kinder und Jugendliche erfolgen, damit diese einen kritischen, faktenbasierten Umgang mit offenen Quellen erlernen. Genauso benötigt es aber Elternarbeit, da viele Eltern die im Netz herumgeisternden Verschwörungstheorien, auf die ihre Kinder stoßen könnten, gar nicht kennen. Auch der Presse und den öffentlich-rechtlichen Medien kommt dabei eine wichtige Funktion zu. Ich habe die Zeit der Corona-Pandemie – neben vielen negativen Effekten – auch als eine Zeit erlebt, in der sich die Wissenschaftskommunikation in Deutschland stark verbessert hat. Auch die Wissenschaft muss ihre Methoden und Erkenntnisse in verständlicher Art und Weise in die Bevölkerung transportieren. Podcasts sind zum Beispiel ein sehr gutes Medium, um komplexe Sachverhalte in der nötigen Zeit auch einmal themenorientiert spezifisch zu beleuchten. Das Medium Podcast hat mit der Pandemie, glaube ich, einen großen Aufschwung erfahren und unsere Gewohnheiten bei der Informationssuche verändert.
Nicht zuletzt müssen Verschwörungstheorien natürlich auch auf einer ideologisch-politischen Ebene dekonstruiert werden. Ich halte diesen Schritt zweifelsfrei für notwendig – als Psychologe würde ich nur davor warnen, sich von dieser inhaltlichen Auseinandersetzung zu viel Wirkung zu erhoffen. Die Motive für den Glauben an Verschwörungstheorien liegen oft tiefer in der Person und haben mit dem Wunsch nach gefühlten Wahrheiten, Sicherheit und Komplexitätsreduktion zu tun. Da ist eine rein inhaltliche Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien oft kontraproduktiv, denn damit nehmen wir den Verschwörungsgläubigen immer etwas weg, was ihnen lieb und teuer geworden ist. Und dies geschieht, ohne dass wir die Lücke gleich mit einer ähnlich einfachen Erklärung füllen könnten. Diese Leute haben viel Zeit und Mühe in die Recherche nach Verschwörungstheorien investiert. Wenn wir jetzt sagen: „Das war ein sehr dummer Fehler, und alles, was du geglaubt hast, ist falsch“, dann versperren wir den Weg zurück in die Gesellschaft eher, als dass wir wirklich helfen. Besser ist es darum, im direkten zwischenmenschlichen Kontakt nur leichte Zweifel zu streuen und klar aufzuzeigen, dass man die Dinge ja auch ganz anders sehen kann. Mit diesem Widerspruch müssen die Betroffenen erst einmal umzugehen lernen und ihn aushalten. In einem zweiten Schritt kann man dann dazu motivieren, dass die Personen selbst einen Faktencheck vornehmen und eigenständig die angeblichen Wahrheiten überprüfen.
Ratschläge sind halt auch Schläge – und damit meist selbstwertgefährdend. Gerade der Selbstwert von Verschwörungsgläubigen ist ja in der Regel bereits angeschlagen, sonst müssten sie sich ja gar nicht in Verschwörungstheorien flüchten. Es wäre also besser, die Person zu motivieren, sich selbst eine andere Faktenlage zu schaffen, als sie von außen mit Faktenchecks zuzuschütten.

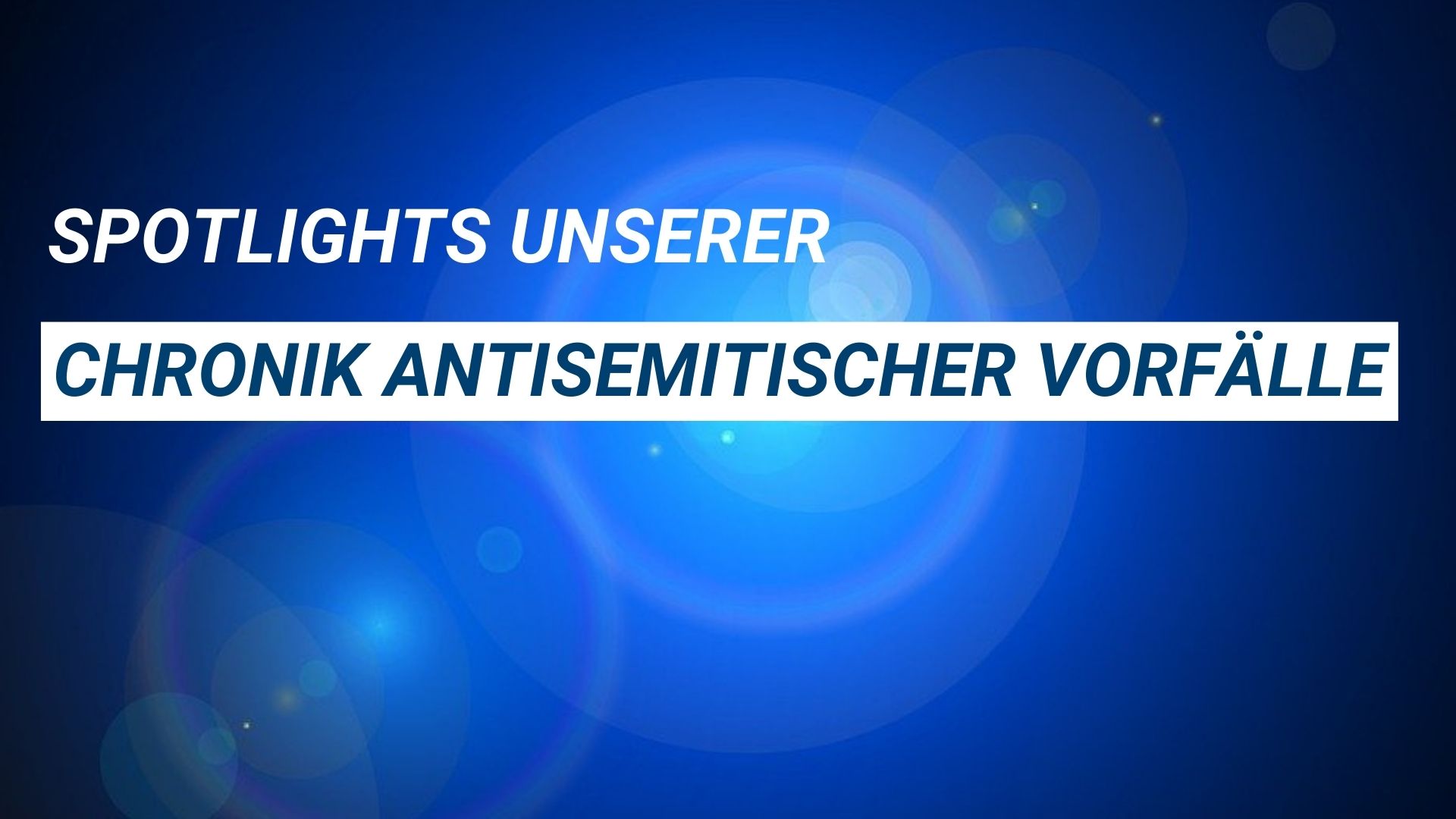
![Aktionswochen_[transfer]_Header_ohne Logos klein](https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2023/11/transfer_Header_ohne-Logos-klein.png)
