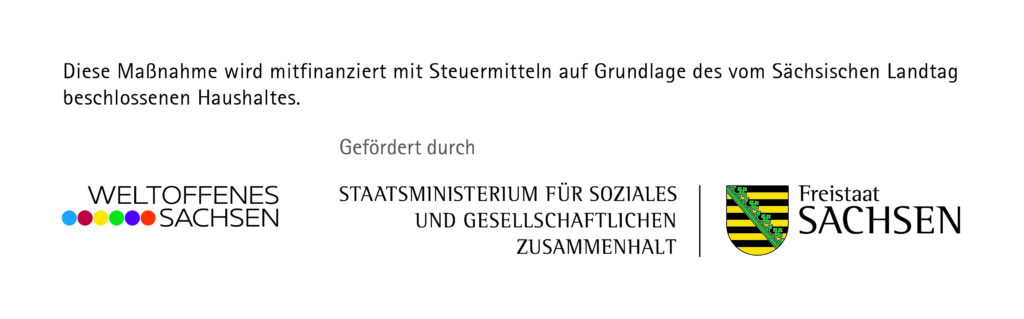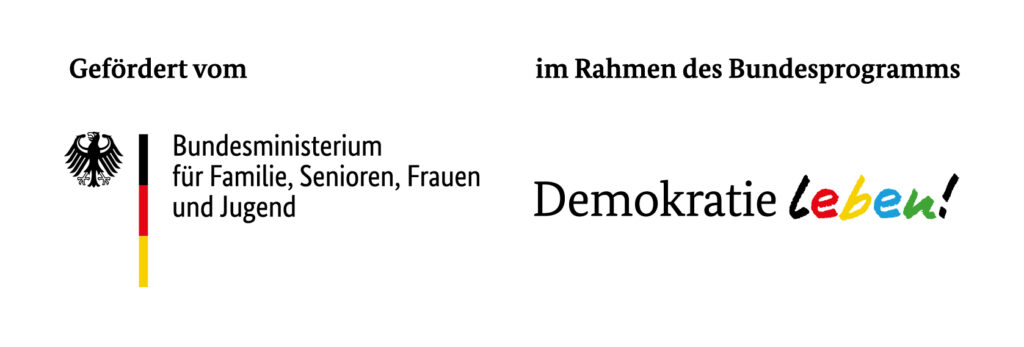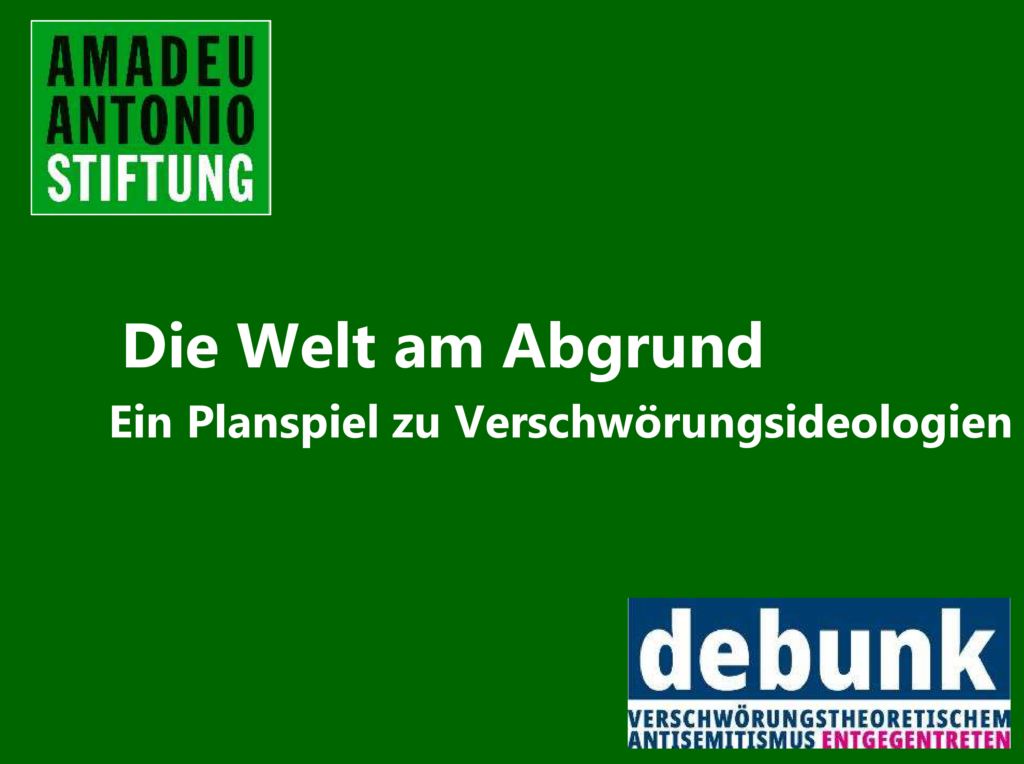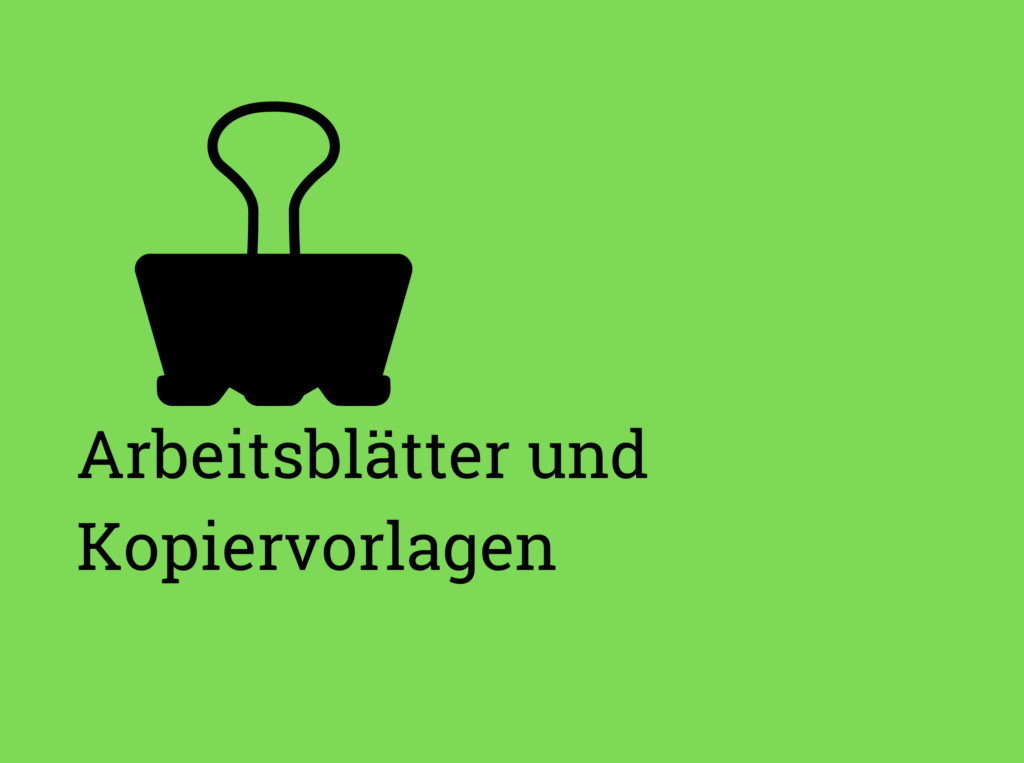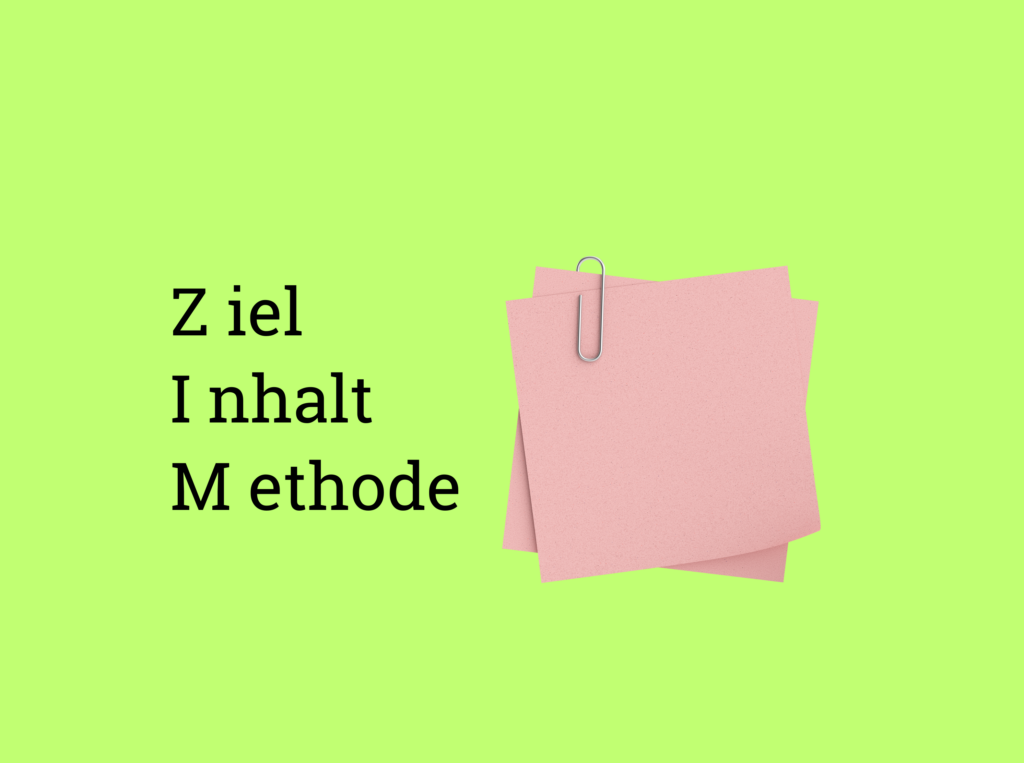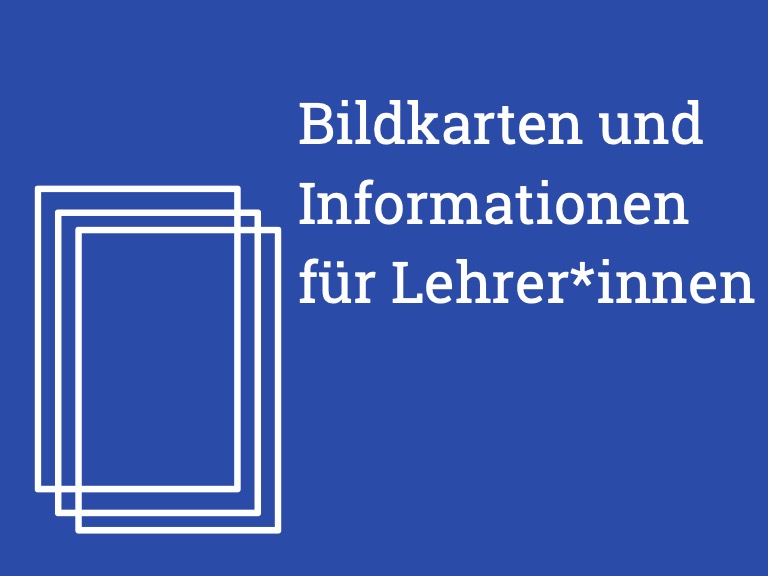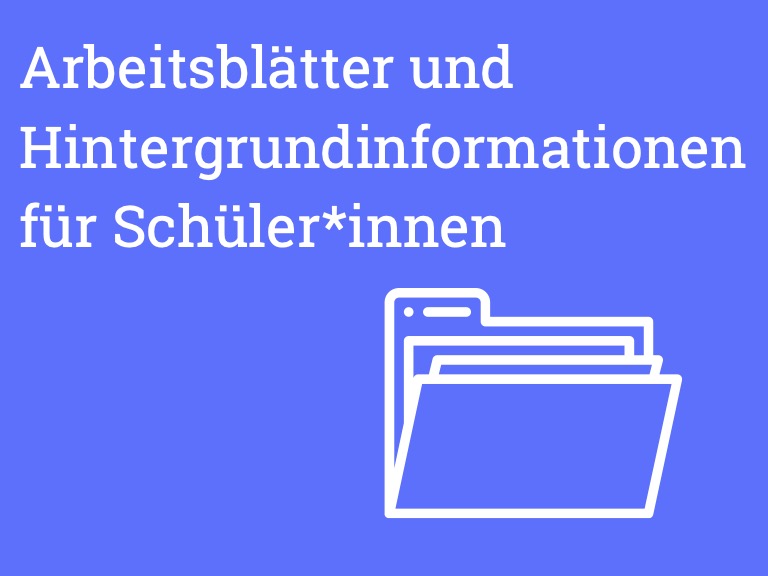verschwörung.info
Wissen, Formate und Empfehlungen zum Umgang mit Verschwörungsideologien und Antisemitismus

Was ist debunk?
Debunk ist ein pädagogisches Projekt mit dem Ziel, die Funktionsweise von Verschwörungsideologien und Antisemitismus Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie pädagogischen Fachkräften zu vermitteln… [mehr]

… Verschwörungsideologien stellen komplexe gesellschaftliche Ereignisse oder Prozesse als Teil einer „jüdischen Weltverschwörung“ dar und bieten autoritäre Lösungsvorschläge an, die sich gegen Minderheiten und die Grundwerte einer freien und offenen Gesellschaft richten. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene sind sie attraktiv: Als Gesellschaftskritik getarnt, werden Antisemitismus und Verschwörungsideologien zum vermeintlichen Ausdruck der Auflehnung gegen reale oder erdachte Autoritäten. Antisemitische Codes, wie beispielsweise das Bild einer geheimen Macht im Hintergrund, zu nutzen und sich als „gute*r Widerstandskämpfer*in“ zu inszenieren, wirkt für junge Leute in der Suche nach Identifikation anziehend. Beides verschleiert den zugrundeliegenden Antisemitismus und ein „sanfter“ Weg zur Radikalisierung kann geebnet sein. Debunk hat sich zum Ziel gemacht Verschwörungsideologien ihre Anziehungskraft für Jugendliche und junge Erwachsene zu nehmen. Während der Projektlaufzeit 2020 bis 2024 wurden konkrete Bildungsangebote in Form multimedialer Produkte erstellt. In Projekttagen und Workshops wurden Jugendliche, junge Erwachsene und Lehrkräfte
darin geschult, antisemitische, verschwörungsideologische und andere antidemokratische Inhalte zu erkennen und sensibilisierte für deren manipulativen Charakter. Das entstandene und bei den Projektveranstaltungen genutzte Material wird nun Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften sowie Multiplikator*innen der Politischen Bildung zugänglich gemacht. Damit werden diese für die eigene Arbeit und Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologien oder Antisemitismus nachhaltig unterstützt.
Formate
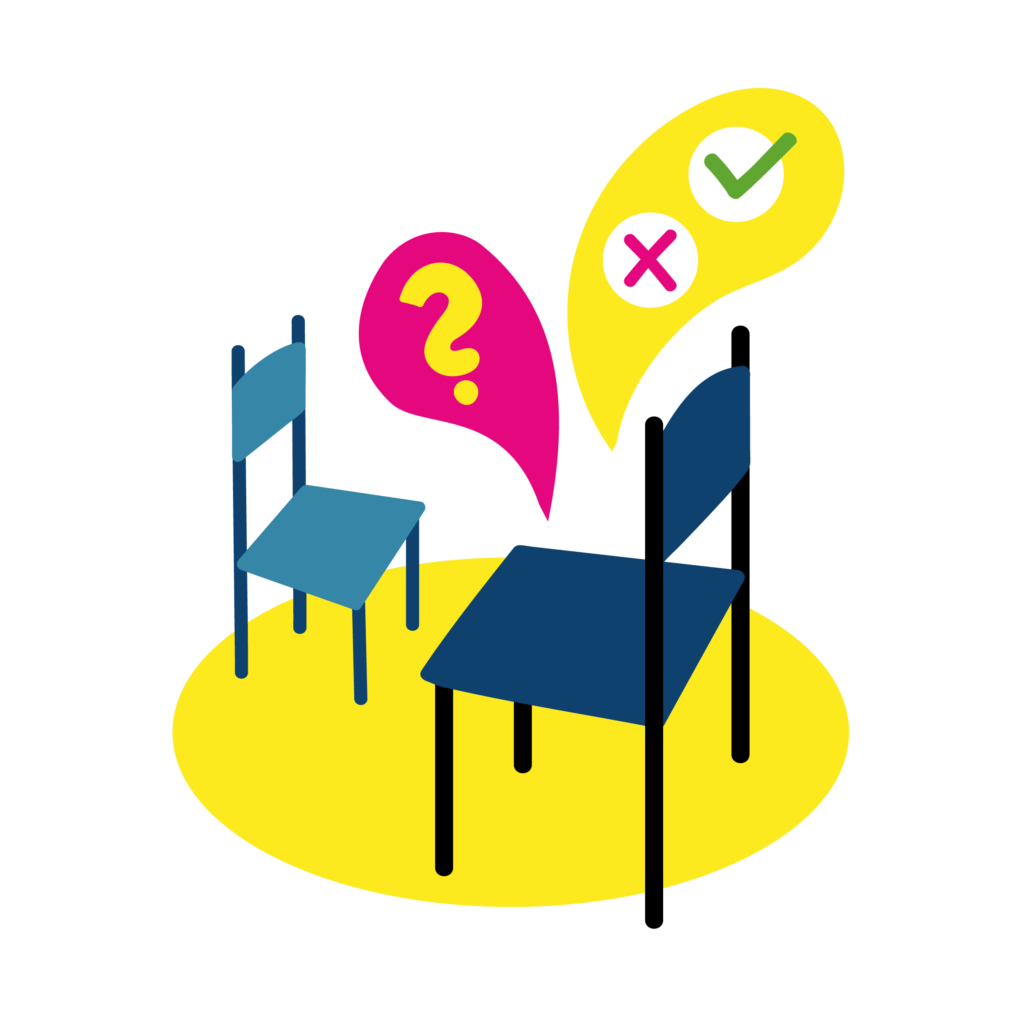
Publikationen
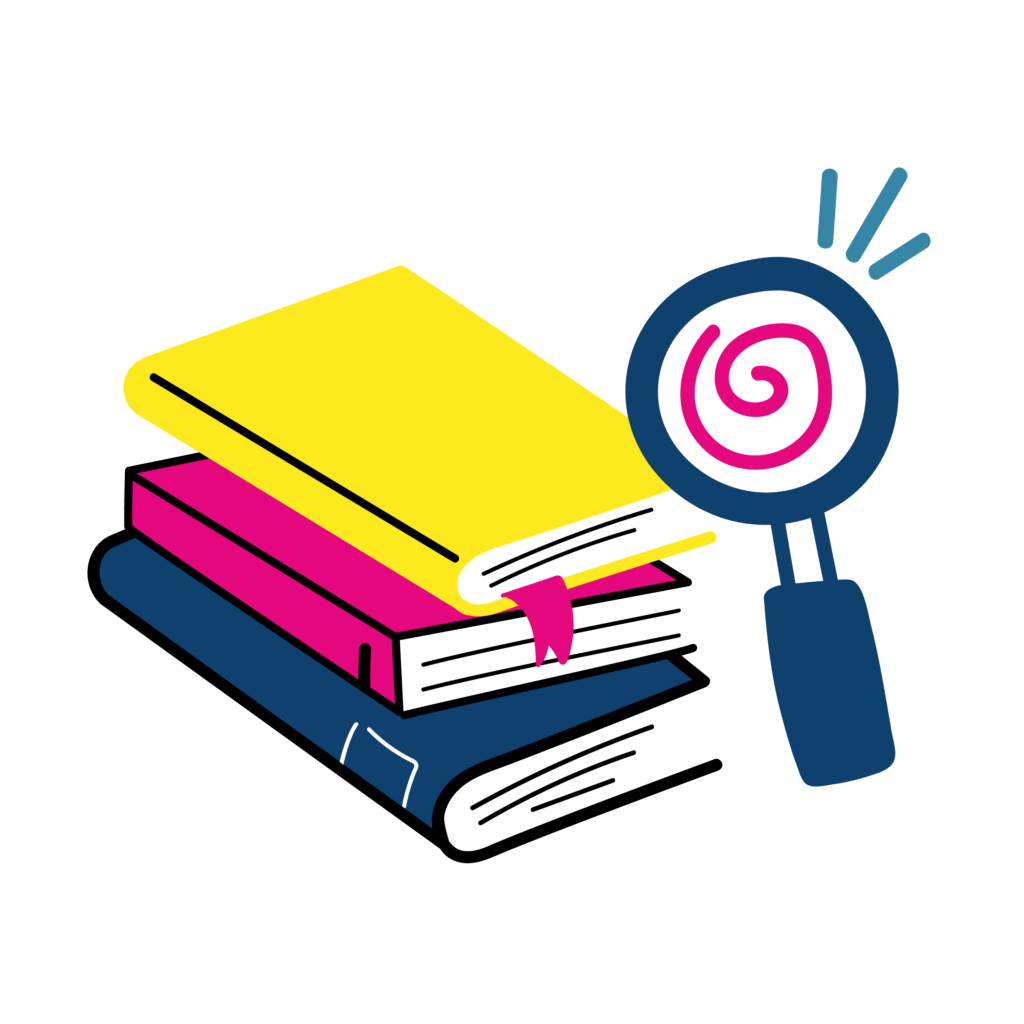
Empfehlungen

Formate
Ein Kernziel des Projektes bestand darin, verschiedene Formate zu entwickeln, mithilfe derer Jugendliche befähigt werden sollen, die Funktionsweise von Verschwörungsideologien zu verstehen und diesen entgegenzutreten.
Die entwickelten Formate reichen von Workshopkonzepten, die pädagogischen Fachkräften als Anleitung bereitgestellt werden, bis hin zum Verschwörungschecker, mit dem Jugendliche selbst Narrative darauf prüfen können, ob es sich bei ihnen um eine Verschwörungserzählung handeln könnte.
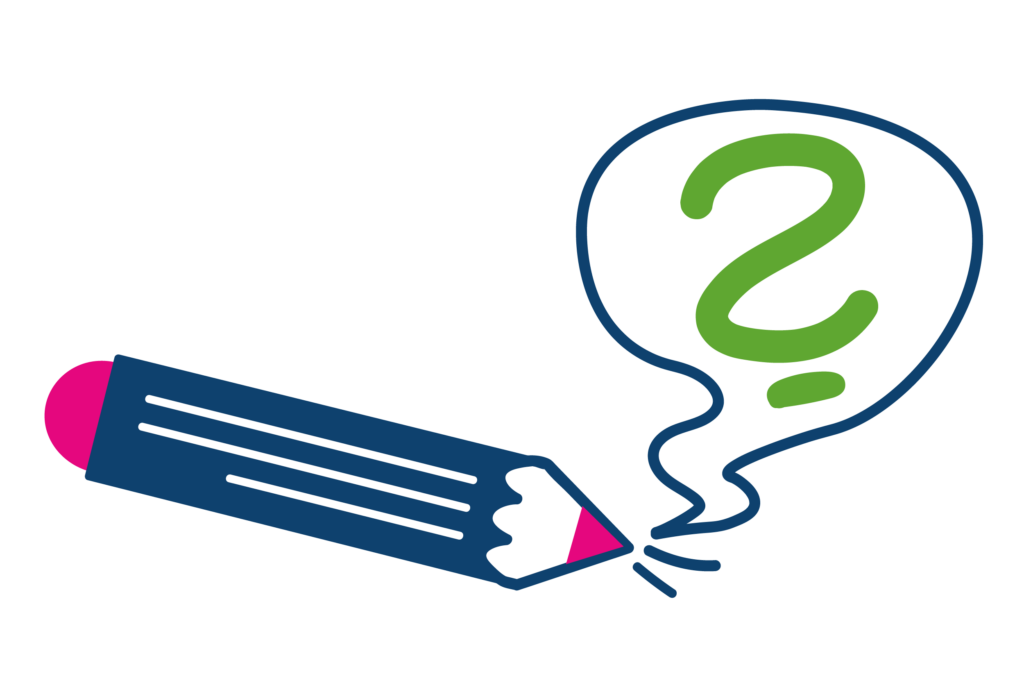
Planspiel Die Welt am Abgrund
Das Planspiel Die Welt am Abgrund versetzt die Schüler*innen in das Szenario einer globalen Katastrophe …
Die Erdlochkatastrophe bedroht Menschenleben. Im Rahmen eines Sondergipfels kommen Politiker*innen und Unternehmer*innen zusammen und müssen Lösungsansätze für die globale Katastrophe entwickeln. Im Spiel gibt es fünf verschiedene Delegationen, die jeweils ganz eigene Erklärungsansätze, sowie Forderungen an die Situation stellen. Dabei vertreten einige der Delegtationen verschwörungsideologische Argumentationen, andere nicht. Jede Schüler*in übernimmt eine aktive Rolle im Spiel und gestaltet den Sondergipfel mit. Mit ihrer Rolle übernehmen sie auch die Einstellung und das Weltbild der jeweiligen Delegation, der sie angehören. Auf der Suche nach der Wahrheit und einer Lösung für die Katastrophe gilt es, ins Diskutieren und Argumentieren zu kommen. Ziel des Planspiels ist es, den Schüler*innen über das eigene Erleben einen interaktiven und reflexiven Zugang zu wesentlichen Merkmalen und Funktionsweisen von Verschwörungsideologien zu vermitteln. Gemeinsam wird erarbeitet, wo die Gefahren von Verschwörungsglaube liegen und welche Zusammenhänge zwischen Antisemitismus und Verschwörungsideologien bestehen. Durchgeführt werden kann das Planspiel von pädagogischen Fachkräften, sowie von erfahrenen Bildungsreferent*innen.
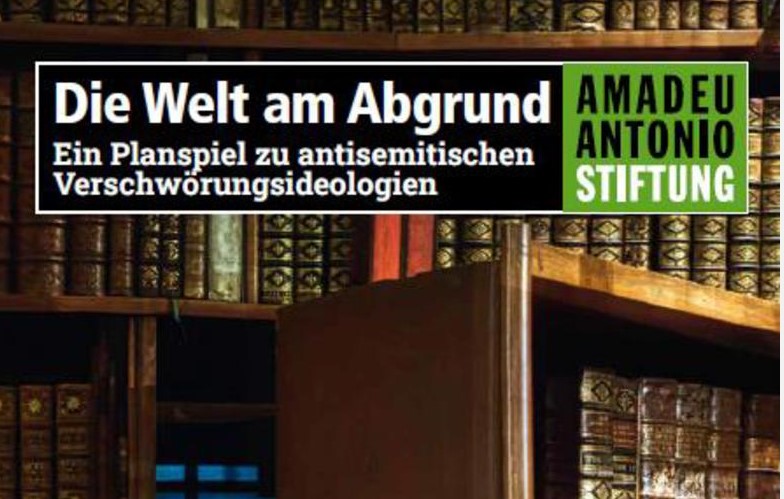
Der VerschwörungsChecker
Der VerschwörungsChecker ist eine Website, welche Besucher*innen dazu einlädt, aufgefundene Verschwörungserzählungen zu testen…
Er orientiert sich an der pädagogischen Grundlage, dass es schwer möglich ist, einer Verschwörungserzählung mit einfachen Faktenchecks zu begegnen. Als Alternative nutzt der VerschwörungsChecker Fragen, die von den Nutzer*innen beantwortet werden müssen. Aus diesen Fragen und ihrer Beantwortung ergibt sich am Ende ein Ergebnis, das den Wahrheitsgehalt der getesteten Erzählung angibt.
Der VerschwörungsChecker wurde im Rahmen von Debunk durch die Agentur “All Codes are beautiful” und das Projektteam entwickelt.
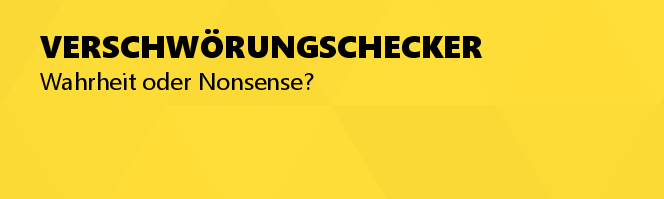
Workshop Die ganze Welt – ein düsterer Ort voller Verschwörungen?
Der Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene setzt am Alltagsverständnis und Gebrauch des Begriff “Verschwörungstheorien” an und vermittelt ein Basisverständnis zum Thema.
Der Workshop befasst sich mit der Schnittstelle aus Antisemitismus und Verschwörungsideologie. Neber einer Grundsensibilisierung für Antisemitismus als Teil vieler Verschwörungserzählungen, geht es auch um die Frage, wie Gesellschaftskritik gelingen kann, ohne dass diese verschwörungsideologisch geprägt ist.
Entstanden ist der Workskhop aus der Arbeit von Debunk im Bündnis gegen Antisemitismus für die Region Ostsachsen und die Stadt Dresden, wo sich das Projekt ab 2020 beteiligt. Unter der Trägerschaft der RAA Sachsen versammeln sich hier jüdische und nicht-jüdische Organisationen und vernetzen die Arbeit gegen Antisemitismus. Im Rahmen eines Projekts des BgA Dresden-Ostsachsen/ RAA Sachsen sind mehrere Workshops über Antisemitismus entstanden, die durch Mitglieder des BgA konzipiert wurden und die in der Folgezeit durch pädagogische Fachkräfte der Region übernommen werden sollen.
Hier findest du das ZIM zum Workshop.

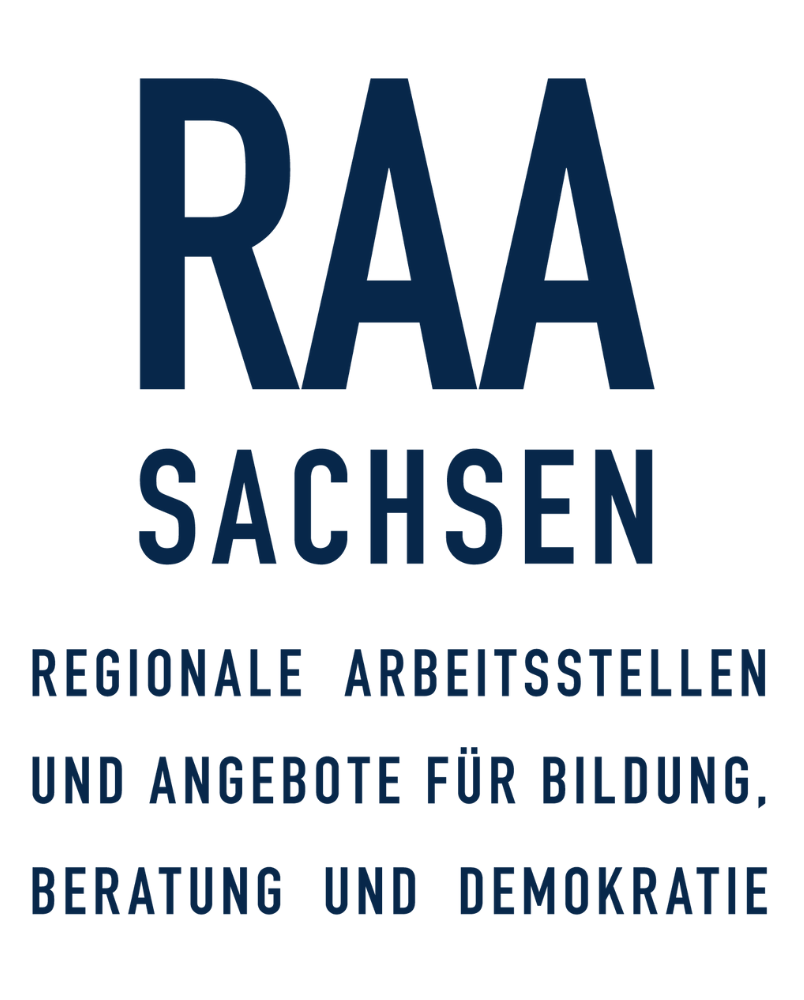
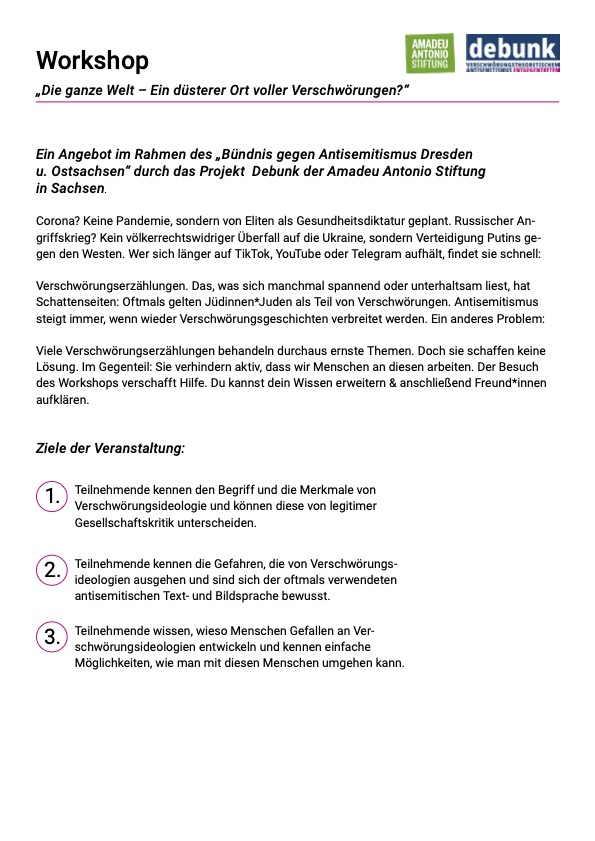
Kartenset für die Fächer Gemeinschaftskunde, Politik, Sozialwissenschaften
Mithilfe unseres Moduls “Verschwörungserzählungen in der Schule” sollen Lehrer*innen dabei unterstützt werden, das Thema niedrigschwellig in den Schulalltag zu integrieren und auf konkrete Vorfälle reagieren zu können.
Denn Verschwörungserzählungen begegnen Jugendlichen in allen Bereichen ihres Lebens, auch in der Schule. Dabei besteht die Herausforderung, dass die Jugendlichen die Verschwörungserzählung als solche überhaupt erstmal erkennen. Das Kartenset hilft dabei.

Fortbildung für Lehrkräfte
Debunk beteiligte sich u.a. an der Erstellung der Inhalte für das Online-Quiz “Conspiracy Virus” …
… Das Projektteam arbeitete während seiner Laufzeit eng mit der Agentur “Kooperative Berlin” zusammen. Auch wurde ein konkretes Fortbildungsmodul für Lehrkräfte entwickelt, das diese zum Thema Verschwörungsideologien und Handlungsmöglichkeiten schult. Die Fortbildung wurde im Juni 2024 zweimal getestet. Das Material fußt auf der jahrelangen Erfahrung von Debunk, welche durch mehrere Hundert Fortbildungen oder Workshops aufgebaut werden konnte.
Das ZIM kann hier heruntergeladen werden.

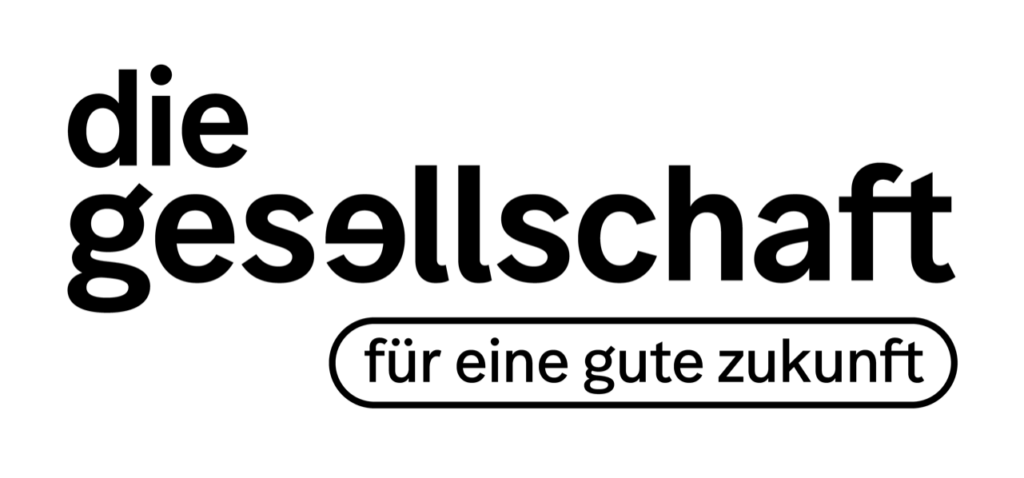

Publikationen
Debunk veröffentlichte während der Projektlaufzeit verschiedene fachspezifische Publikationen. Von der kooperativen Veröffentlichung einer Metastudie zur Verschwörungsmentalität im Jugendalter mit dem Else-Frenkel-Brunswik Institut bis hin zu einem Lernplakat, das Jugendliche dafür sensibilisieren soll, wo ihnen Verschwörungserzählungen begegnen und wie sie darauf reagieren können.
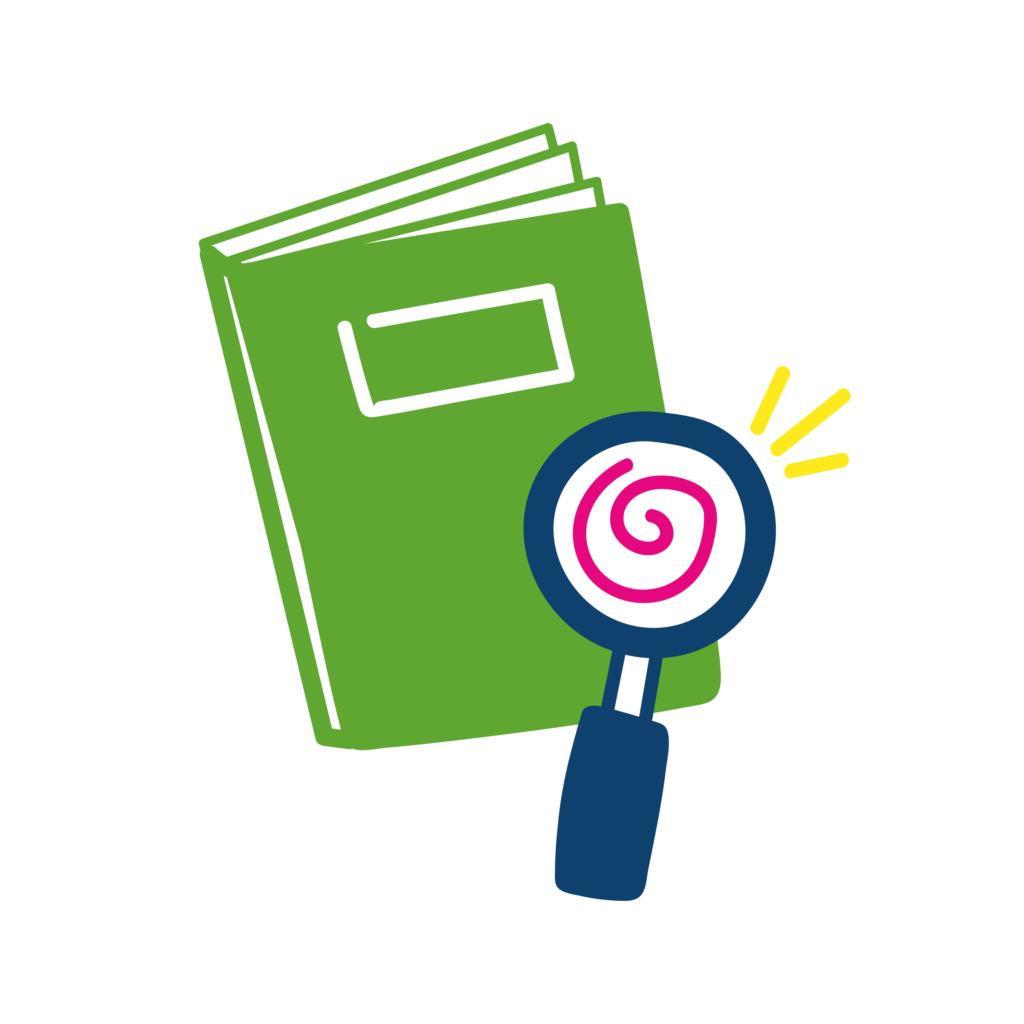
Veröffentlichungen im Digitalreport des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts
- Corona-Proteste in Sachsen: Telegram-Gruppen und -Kanäle beschleunigen Radikalisierung (2022-0)
- Extrem Rechte Online: Mobilisierung zwischen Corona und Krieg (2022-1)
- Ausstieg aus der Demokratie: Extrem rechte Parallelstrukturen in Sachsen (2022-2)
- Digitale Mobilisierung für den „Wutwinter“(2022-3)
- Rückgang der Mobilisierung – Fortsetzung der Agitation (2023-1)
- Vernetzung und aktuelle Entwicklungen in der rechten Telegram-Szene Sachsens (2023-2)
- Antifeminismus und Queerfeindlichkeit in der sächsischen Telegram-Szene (2023-3)
- Reaktionen der extrem rechten sächsischen Telegram-Szene auf den 7. Oktober (2024-1)
Empfehlungen
An dieser Stelle möchten wir einige Empfehlungen für die Bildungsarbeit zu Verschwörungsideologien mit der Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene aussprechen. Neben der Bildungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen bietet die Amadeu Antonio Stiftung auch Empfehlungen für die Bildungsarbeit mit Erwachsenen in der Broschüre Entschwörung mit Format. Neue Wege der Erwachsenenbildung.

Orientierung spenden
Die Teilnehmenden einer Veranstaltung oder die Leser*innen einer Handreichung wissen, dass der Begriff Verschwörungstheorie ungenau ist und eine stärkere Differenzierung erfordert. Bewährt hat sich beispielsweise das Modell des Politikwissenschaftlers Armin Pfahl-Traughber. Es unterscheidet zwischen einer realen Verschwörung, einem Verschwörungsverdacht (Verschwörungshypothese) und einer Verschwörungsideologie. Mit Hilfe des Modells können die Teilnehmenden verschiedene Verschwörungserzählungen, die ihnen im Alltag begegnen (z.B. „Labor-Theorie“ oder „9/11“) einordnen. Der Begriff Verschwörungsideologie ermöglicht es, das Muster der spezifisch demokratie- und menschenfeindlichen Varianten von Verschwörungserzählungen zu erkennen und diese im Alltag zu kritisieren. Dabei sollte auch auf den antisemitischen Grundton hingewiesen werden.
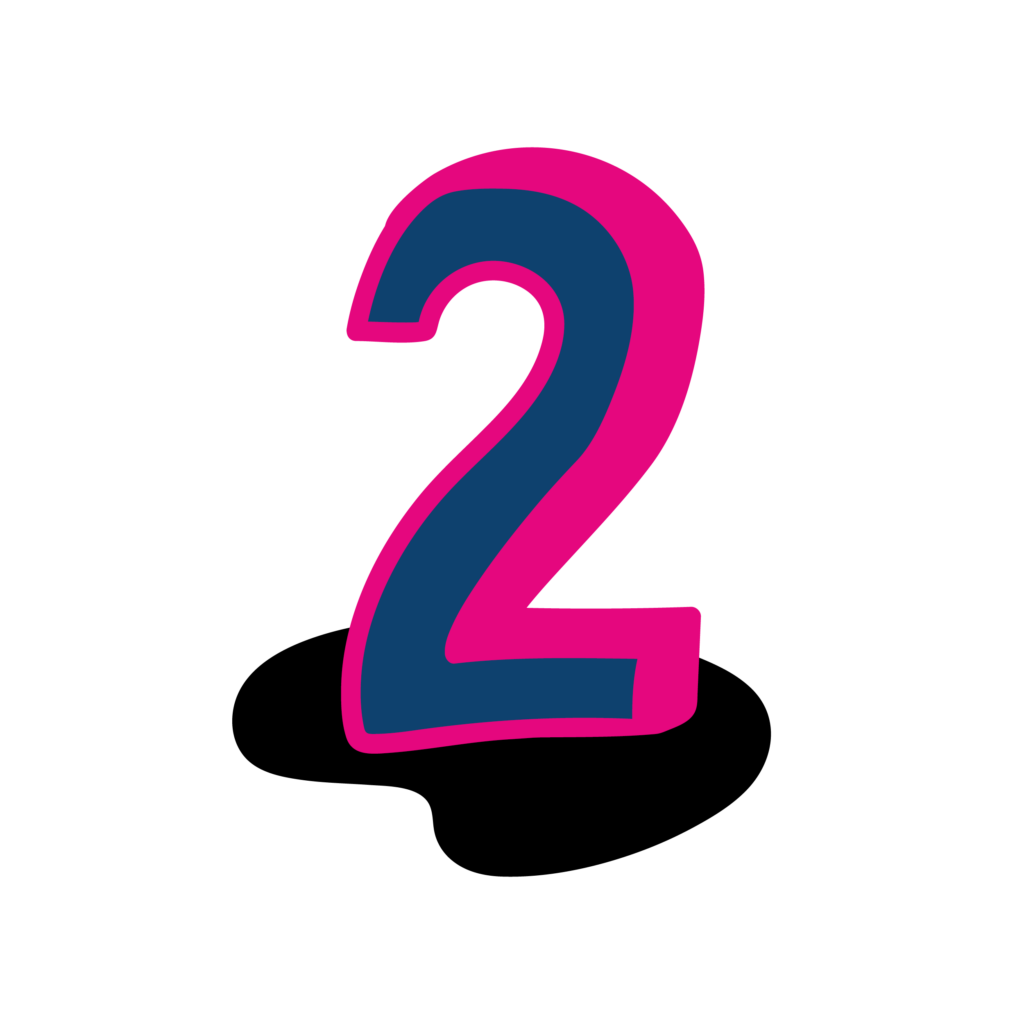
An die Lebenswelt anknüpfen
Junge Menschen machen in der Regel frühe Erfahrung mit Verschwörungserzählungen. Wahlweise weil diese Gegenstand der Unterhaltungsindustrie sind (bspw. „Außerirdische auf der Erde“) oder weil radikale Akteur*innen Jugendliche als Zielgruppe haben (bspw. rechtsextreme Organisationen).
Bildungsveranstaltungen oder Aufklärung im Netz sollte junge Menschen dort abholen, wo sie diese Erfahrungen machen. Anstelle von abstrakten oder weit entfernten Beispielen, sollte über die Inhalte gesprochen werden, die gerade aktuell für junge Menschen sind (bspw. Verschwörungserzählungen in Zusammenhang mit Pop-Kultur oder Gender/Geschlecht). Dabei kann und sollte auch mit den Jugendlichen über die Konsequenzen und Gefahren gesprochen werden, die durch die Verbreitung entstehen.

An die Gefühle und Bedürfnisse denken
Verschwörungserzählungen verhaften auch deswegen bei vielen Menschen, weil diese positive wie negative Gefühle wachrütteln, die wichtig sind: In der Fachsprache ist von affektiven Funktionen die Rede. Am wichtigsten ist dabei das Gefühl beziehungsweise das Bedürfnis nach Identifikation sowie Erkenntnis oder Sinnstiftung. Die Überforderung, die viele Menschen mit der modernen Welt spüren, führt beispielsweise zu der Sehnsucht nach eindeutigen Mustern oder Erklärungsansätzen, wie sie in Verschwörungserzählungen zu finden sind. Genau über diese Aspekte sollte gesprochen werden. Eine Grundfrage dabei lautet: “Wie nimmst du die Welt wahr, in der wir leben?” oder „Woher kommt das Bedürfnis nach Eindeutigkeit oder Klarheit, wenn du auf die Welt blickst?“

Keine bloße Unterhaltung
Es mag zwar für manche witzig oder unterhaltsam sein, einem “Flat-Earthler” bei TikTok zu folgen oder sich einen Vortrag von Daniele Ganser bei YouTube anzusehen, es darf aber dabei nicht vergessen werden: In der Regel fördern Verschwörungsideologien negative Gefühle und Empfindungen in Bezug auf die demokratische und liberale Gesellschaft, in der wir leben. Politiker*innen oder Wissenschaftler*innen erscheinen dadurch als Betrüger*in oder Lügner*in. Geflüchtete als Invasor*innen oder LGBTQI Personen als Gefahr für Kinder. Indirekt wird auch zum Widerstand oder Gewalt gegen Menschen aufgerufen. Insbesondere antisemitische Gefühle nehmen zu und richten sich bei manchen Menschen direkt gegen jüdische Personen.

Keine abstrakten Gefahren
Anhand des Beispiels zahlreicher politisch motivierter Gewalttaten können konkrete Gefahren, die von Verschwörungsideologien ausgehen, vermittelt werden. Die Geschichte des Attentäters von Halle/Saale, der am 9. Oktober 2019 versuchte, bewaffnet in eine Synagoge einzudringen, um dort möglichst viele jüdische Personen zu ermorden, zeigt den potenziell tödlichen Charakter von Verschwörungsideologien. Der Konsum von Hass, Hetze und Desinformation in Online-Welten oder auch in der direkten Umgebung von Menschen, kann zur Legitimation und Anwendung von Gewalt führen. Es ist wichtig, dass junge Menschen diese konkreten Gefahren für sich oder auch ihre Umfelder kennen.

Verschwörungsideologien sind nicht neu
Altes, reaktionäres Wissen wird durch vermeintlich aktuelle Verschwörungserzählungen erneuert. Seit jeher diente die Verbreitung von Verschwörungserzählungen dem Machterhalt oder Machterwerb von Menschen. In der deutschen Geschichte finden sich viele Beispiele. Indem junge Menschen konkrete Beispiele für die historische Verwendung von Verschwörungsideologie kennen (bspw. die Dolchstoßlegende in den 1920er Jahren beförderte den Aufstieg der NSDAP in den 1930er Jahren), sind sie auch besser in der Lage, die Neuauflagen in der heutigen Zeit zu erkennen. Das gilt besonders auch für antisemitische Ideologien wie beispielsweise die Verbindung aus mittelalterlicher Ritualmordlegende und QAnon-Mythos in unserer Zeit.
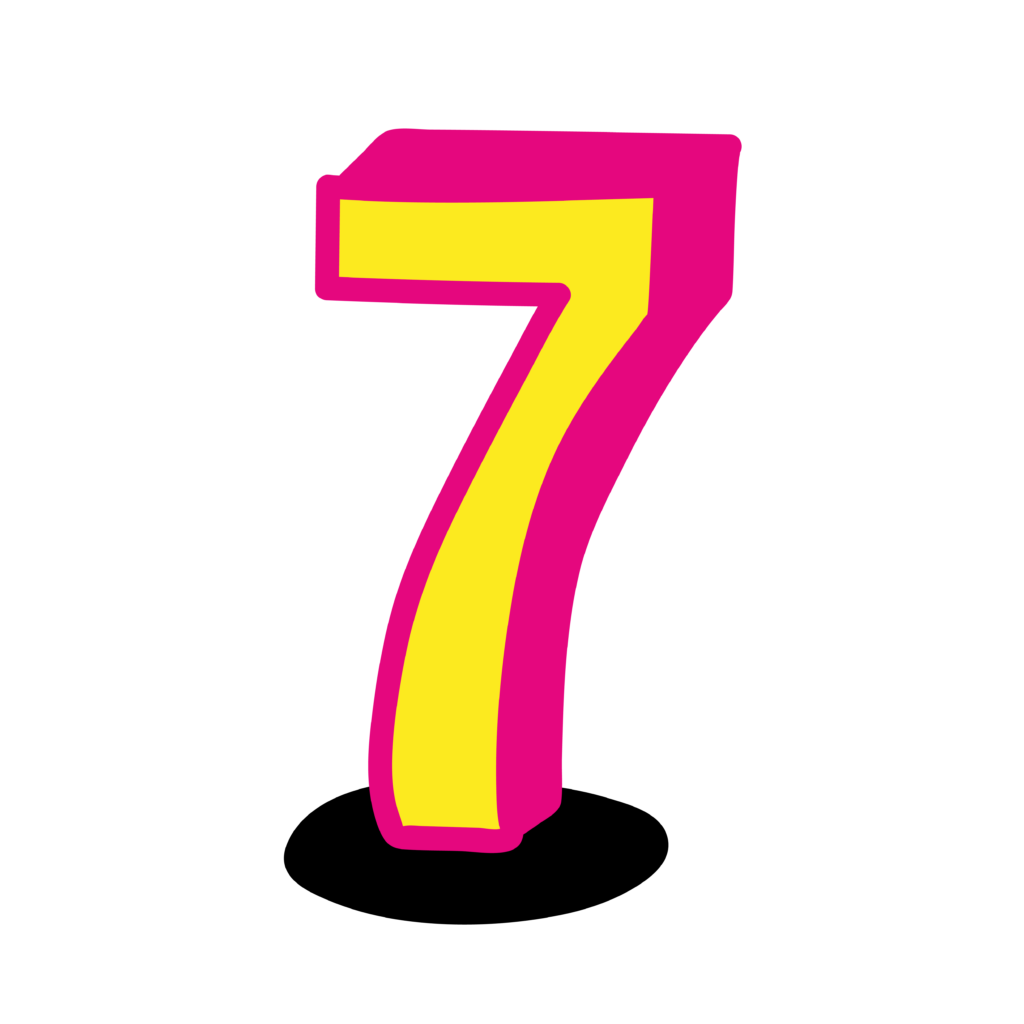
Verschwörungsideologien behindern gesellschaftliche Teilhabe
Der Konsum von Verschwörungsideologien regt nicht zur aktiven Gestaltung der eigenen Umgebung an: Radikale Akteur*innen, welche Verschwörungsideologie vermitteln, wollen zwar die Wut und die Empörung von Menschen mobilisieren, sie wollen diese aber nicht zu aktiven Gestalter*innen der eigenen Umwelt werden lassen. Dies kann in der Bildungsarbeit genutzt werden! Hilfreich ist, wenn konkret über Missstände oder Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen gesprochen wird. Veranstaltungen oder Handreichungen sollten Hilfestellungen bieten, wie man vom passiven zum aktiven Gestalter*in werden kann. Indem Erfahrungen der Selbstwirksamkeit angeregt oder erzeugt werden, kann Verschwörungsdenken reduziert und Teilhabe gefördert werden.

Jede*r kann etwas tun
Verschwörungsideologien führen zwar manchmal zur Sprachlosigkeit, es gibt aber Hilfe! Indem durch die Bildungsangebote konkret an der Frage gearbeitet wird, was jede*r machen kann, der mit Verschwörungsideologie konfrontiert ist, kann zugleich die Motivation zum Gegen-Handeln erhöht werden. Die Palette reicht von relativ einfachen Handlungen, wie der Meldung eines Inhalts auf den Online-Plattformen, über die Kenntnis und Nutzung von Beratungsangeboten bis hin zum geübten Gegen-Argumentieren. Inzwischen stehen auch einige Hilfsangebote im Internet zur Verfügung. Hier kann beispielsweise das Debunking geübt oder das Prebunking genutzt werden.

Kein Schwarz-Weiß-Denken reproduzieren
Verschwörungsideologien reagieren auf die Unübersichtlichkeit und das manchmal vorhandene Chaos in der Welt mit scheinbarer Klarheit und Einheitlichkeit. Das schafft bei manchen das Gefühl von Orientierung, Kontrolle oder Sicherheit. Bildungsangebote sollten hierauf nicht mit eigenem vereinfachten Denken reagieren. Ein beliebter Mechanismus lautet: Hinter jeder Verschwörungsideologie stecken ausschließlich Lügen und die Unwahrheit. In dem Sinne erscheinen Menschen, die verschwörungsideologisch denken oder fühlen als weniger intelligent oder kompetent. Anstelle des verschwörungsideologischen Denkens muss aber die Befähigung zur Ambiguität also Mehrdeutigkeit oder Uneindeutigkeit treten. Dies kann z.B. durch das Frage-Antwort-Verhalten der Trainer*innen oder die Analyse aktueller Ereignisse vorbildhaft vorgelebt werden. Auch kann verdeutlicht werden, wie sich Wissen und Erkenntnis über die Zeit verändert haben.

Verschwörungsideologien fallen nicht vom Himmel
Es gibt in Deutschland ein großes Milieu von Magazinen, Internetseiten, Social-Media-Profilen, politischen Akteur*innen oder Vortragenden, welche Verschwörungsideologien professionell verbreiten. Indem sich Teilnehmende damit auseinandersetzen und bspw. deren Verstrickung in radikale Kreise erkennen, können diese gewarnt werden. Zugleich sollte darauf geachtet werden, dass die Webseiten, Social-Media-Kanäle etc. nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es wird empfohlen, keine unnötige Werbung zu betreiben und Autor*innen nur dann zu nennen, wenn es der Aufklärung dienlich ist. Ein positives Beispiel hierfür ist das Online-Tool Swipe Away der Amadeu Antonio Stiftung.
Grafiken: Mandy Münster
Redaktionsleitung: Sophie Nissen