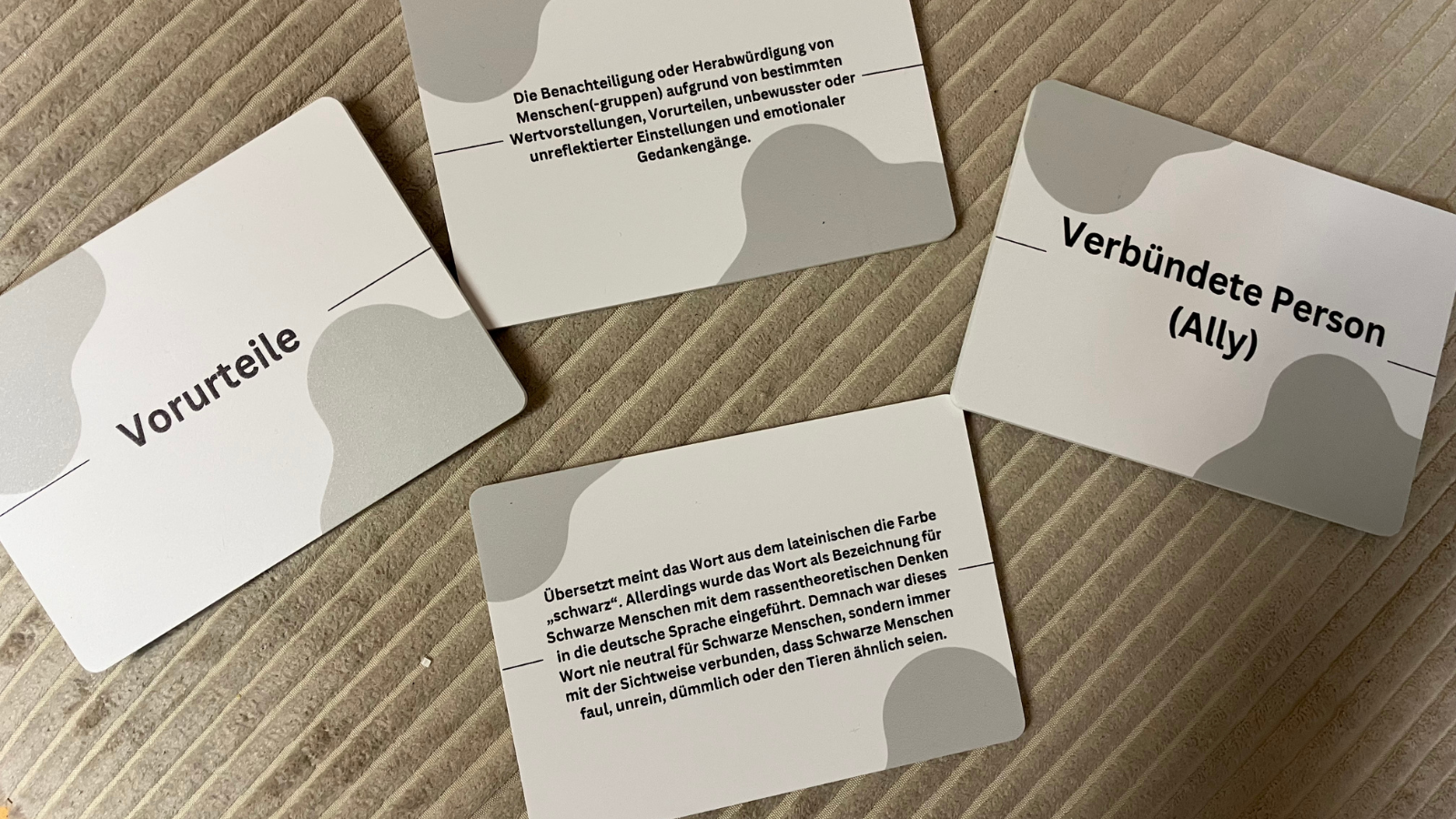Im Gespräch erzählt Tahir Della, Aktivist und Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD), was Sicherheit für Schwarze Menschen bedeutet, warum Empathie eine politische Haltung ist – und weshalb Hoffnung immer auch Widerstand bedeutet.
Für viele Schwarze Menschen in Deutschland ist Sicherheit kein selbstverständlicher Zustand, sondern etwas, das erkämpft, verteidigt und immer wieder neu eingefordert werden muss.
Tahir Della ist seit 1986 Aktivist der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) und fester Bestandteil der jüngeren Schwarzen Bewegung der Bundesrepublik. Seit der Gründung des bundesweiten ISD-Verbandes im Jahr 2001 war er bis 2019 im Vorstand aktiv und an der Koordinierung bundesweiter und lokaler Aktivitäten beteiligt. Seit Januar 2016 besetzt er die Promotorenstelle im Berliner Promotorenprogramm für Dekolonisierung und Antirassismus, die von der ISD betreut wird.
Im Interview spricht Tahir Della über Sichtbarkeit, gesellschaftliche Verantwortung und darüber, warum Sicherheit keine individuelle, sondern eine gemeinsame Aufgabe ist. Er erinnert daran, dass Sicherheit nicht darin besteht, die Komfortzone der Mehrheit zu schützen, sondern darin, eine Gesellschaft zu schaffen, in der niemand Angst haben muss.
Was bedeutet Sicherheit für dich?
Tahir Della: Sicherheit bedeutet für mich, dass Schwarze Menschen gesehen, geschützt und mitgedacht werden, in politischen Entscheidungen, in öffentlichen Debatten, im Alltag. Es darf nicht länger darum gehen, die Komfortzone der Mehrheit zu schützen, während marginalisierte Menschen täglich Angst haben müssen.
Wie erklärst du dir, dass Positionen, die früher als selbstverständlich demokratisch galten, heute zunehmend diffamiert werden?
Tahir Della: Aktuell können wir einige Diskursverschiebungen beobachten: Was früher selbstverständlich demokratisch war, wird heute plötzlich als „linksextrem“ diffamiert.
Wie und wo beobachtest du das?
Tahir Della: Es ist wirklich erstaunlich, was momentan abgeht, auch, welche Debatten gerade geführt werden. Ich habe mich neulich mit einer Kollegin unterhalten, was all die Anfragen von der extremen Rechten eigentlich mit sich bringen. Wir gehen jetzt nicht von einem Umsturz aus, aber man merkt, dass viele Parlamentarier*innen zunehmend genervt sind von diesen Anfragen und das teilweise eins zu eins an die Zivilgesellschaft weitergeben, so nach dem Motto: „Übertreibt ihr es nicht gerade?“, etwa wenn es um Fördergelder oder politische Forderungen geht.
Und das ist wirklich beispiellos. Wenn zum Beispiel politische Werbung heißt, dass man für Menschenrechte eintritt, dann ist es höchste Zeit, genau hinzuschauen, was eigentlich passiert und was sich verändern muss.
Das heißt, Engagement für Menschenrechte wird zunehmend problematisiert?
Tahir Della: Ja, genau. Und das ist gefährlich, weil dadurch Menschen, die Haltung zeigen, unter Druck geraten.
Wo werden Schwarze Menschen aktuell nicht gesehen, geschützt und mitgedacht? Wo zeigt sich das konkret?
Tahir Della: Das mit dem „Gesehenwerden“ ist vielleicht ein bisschen verschnörkelt ausgedrückt. Ich meine nicht, dass Schwarze Menschen unsichtbar sind – im Gegenteil. Sie sind sichtbar. Aber sie werden oft nicht mitgedacht, wenn es um gesellschaftliche Debatten geht, besonders wenn es um Sicherheit im öffentlichen Raum geht.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo diese Perspektive fehlt?
Tahir Della: Das sind ja Themen, die gerade in Berlin, aber auch anderswo diskutiert werden. Wenn es um Schutz und Sicherheit im öffentlichen Raum geht, dann reagiert man meist auf gewalttätige Übergriffe, die natürlich zu verurteilen sind und auch Maßnahmen erfordern. Aber es wird viel zu selten gefragt: Was sind eigentlich die sozialen Ursachen solcher Verhältnisse und inwieweit werden oder müssen sie mit einbezogen bei der Bearbeitung.
Und was fast nie vorkommt, ist, dass die Erfahrungen von Menschen of Color, migrantischen Menschen und Schwarzen Menschen dabei berücksichtigt werden. Es gibt ja weiterhin diese sogenannten No-Go-Areas, also Orte in denen sich Schwarze Menschen nicht gefahrenlos bewegen können und das ist kein neues Thema. Schon bei der Fußball-WM in Deutschland wurde darüber gesprochen. Diese Unsicherheitszonen bestehen also bis heute fort?
Tahir Della: Ja, absolut. Das hat sich bis heute nicht wirklich verändert. Im Gegenteil, es passiert immer noch. Und das zeigt, dass wir einen sehr einseitigen Blick auf Sicherheit haben: Es wird immer gefragt, wessen Sicherheit ist hier eigentlich gemeint?
Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, es geht nicht darum, zu sagen, welche Form von Gewalt schlimmer ist. Aber wir müssen anerkennen, dass Schwarze Menschen und migrantische Menschen nicht nur Opfer von rassistischer Gewalt werden, sondern auch von staatlichen Strukturen Unsicherheit erfahren, etwa durch anlasslose Polizeikontrollen und die daraus resultierende Gewalt.
Also wird Sicherheit staatlich definiert, aber nicht für alle gleich erlebt?
Tahir Della: Genau. Das ist eine der größten Widersprüche in dieser Debatte. Wenn über Sicherheit gesprochen wird, dann selten darüber, dass staatliche Institutionen selbst dazu beitragen können, dass sich bestimmte Gruppen unsicher fühlen.
Viele Perspektiven bleiben also außen vor. Woran liegt das?
Tahir Della: Oft wird Sicherheit im Wahlkampf instrumentalisiert. Gewisse Zielgruppen sollen sich angesprochen fühlen und andere werden bewusst ausgeblendet. Das ist Teil des Problems.
Du sprichst auch an, dass vor allem die Komfortzone der Mehrheit geschützt wird. Wer müsste wo etwas anders machen?
Tahir Della: Wenn ich das als Appell formulieren darf: Wir müssen uns als Gesamtgesellschaft fragen, in welcher Art von Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Wenn es für manche Menschen alltäglich ist, dass sie im öffentlichen Raum um ihre Sicherheit bangen müssen, dass sie angegriffen, belästigt, bedrängt oder diskriminiert werden, dann ist das ein Zustand, den wir nicht hinnehmen dürfen.
Was wäre aus deiner Sicht ein erster Schritt, das zu verändern?
Tahir Della: Da sind alle gefragt, sich zu positionieren, Haltung zeigen und zwar nicht nur dort, wo es bequem ist. Es reicht nicht, sich zu engagieren, wenn alltägliche Gewalt gesellschaftlich akzeptiert wird
Es darf nicht sein, dass Empathie und Engagement davon abhängen, wer betroffen ist. Wenn wir von Menschenrechten und diskriminierungsfreiem Zusammenleben sprechen, dann muss das für alle gelten. Sonst machen wir uns selbst etwas vor.
Wir müssen weg von symbolischen Floskeln wie „Rassismus hat keinen Platz“ oder „Wir sind eine vielfältige Gesellschaft“. Das sind schöne Sätze, aber sie müssen mit Praxis gefüllt werden. Menschen müssen lernen, zu intervenieren, wenn sie Diskriminierung oder Gewalt beobachten.
Das fordern wir von der ISD Bund auch immer wieder ein: Dass sich alle in der Gesellschaft angesprochen fühlen – nicht nur, wenn es um Gruppen geht, die ihnen nahestehen. Solidarität darf nicht selektiv sein.
Heißt das, Sicherheit entsteht erst, wenn Menschen aktiv eingreifen?
Tahir Della: Ganz genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt: Wenn wir über Sicherheit sprechen, müssen wir klar benennen, wessen Sicherheit überhaupt gemeint ist. Oft wird im Namen von Sicherheit gehandelt, aber die Maßnahmen treffen genau diejenigen, die ohnehin schon am stärksten betroffen sind, etwa durch Racial Profiling oder durch verschärfte Polizeigesetze. Das sind dann Maßnahmen, die angeblich Sicherheit schaffen sollen, aber in Wahrheit Unsicherheit verstärken.
Wird es derzeit sicherer oder unsicherer für Schwarze Menschen in Deutschland?
Tahir Della: Ich würde sagen: Es wird eher unsicherer. Und das liegt vor allem daran, dass viele Themen nicht richtig adressiert werden. Dieses starke Bedürfnis nach Sicherheit, das jetzt so oft beschworen wird, das gab es ja noch nie wirklich für alle. Aber derzeit wird es auf eine Art thematisiert, die sehr reflexartig ist.
Man glaubt, Sicherheit könne man dadurch herstellen, dass man Menschen abschiebt oder ausschließt. Doch das löst die Probleme nicht. Es verlagert sie nur und zwar auf diejenigen, die ohnehin schon Zielscheibe von Angriffen und Ausgrenzung sind.
Das heißt, politische Maßnahmen verschieben das Problem eher, als es zu lösen?
Tahir Della: Genau. Echte Sicherheit würde heißen, dass niemand befürchten muss, Ziel von staatlichen Maßnahmen oder gesellschaftlichen Angriffen zu werden. Doch im Moment wird das Thema Sicherheit oft genutzt, um von eigener Verantwortung abzulenken, vom Versagen staatlicher Strukturen oder vom fehlenden Schutz marginalisierter Gruppen. Das führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu mehr Angst.
Wie gehst du persönlich mit dieser Entwicklung um?
Tahir Della: Ich versuche, mir das immer wieder bewusst zu machen und aktiv zu bleiben. Vor kurzem gab es im Berliner Wedding eine Kundgebung zum Thema Straßenumbenennungen. Am Rande davon habe ich eine Szene beobachtet, in der ein junger Mann und eine junge Frau gestritten haben. Ich bin hingegangen und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob sie Unterstützung braucht.
Sie sagten, es sei alles gut, sie hätten nur herumgealbert, aber sie hat sich bedankt, dass wir hingegangen sind.
Also hinsehen und präsent sein?
Tahir Della: Genau. Das sind Kleinigkeiten, aber genau darum geht’s: hinsehen, fragen, präsent sein.Man muss nicht immer eingreifen oder riskieren, dass etwas eskaliert. Aber allein das Wahrnehmen und Ansprechen kann einen Unterschied machen.
Natürlich überlege ich auch manchmal: „Soll ich mich da jetzt einmischen? „Könnte das gefährlich werden?““ Diese Gedanken kennt wahrscheinlich jede*r. Aber ich versuche, mich davon nicht lähmen zu lassen. Lieber frage ich einmal zu viel, ob jemand Hilfe braucht, als dass etwas passiert und ich untätig bleibe.
Das ist auch ein Appell für gesellschaftliche Aufmerksamkeit, oder?
Tahir Della: Absolut. Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der viele lieber auf sich selbst schauen. Doch Sicherheit entsteht nicht individuell, sondern im Miteinander.
Was können wir aus den Schwarzen Kämpfen der letzten Jahrzehnte für die heutige Zeit lernen?
Tahir Della: Ich glaube, das Wichtigste ist: dranbleiben. Nicht lockerlassen, wenn es darum geht, Veränderungen einzufordern und Prozesse anzustoßen, die für die ganze Gesellschaft wichtig sind.
Ich bin ja fast 40 Jahre bei der ISD aktiv und in dieser Zeit gab es viele Höhen und Tiefen. Phasen, in denen unklar war, ob es überhaupt weitergeht und dann wieder Momente, in denen klar wurde, wie notwendig Selbstorganisationen wie die ISD sind. Denn ohne sie würden viele Diskurse gar nicht stattfinden.
Was hat sich durch dieses lange Engagement konkret verändert?
Tahir Della: Wenn man sich allein das Thema Sprache anschaut, ist das ein riesiger Fortschritt.
In den 1980er Jahren war die öffentliche Sprache voll von rassistischen Fremdbezeichnungen. Heute spricht eine Tagesschausprecherin selbstverständlich von Afrodeutschen. Das ist eine Entwicklung, die zeigt, dass Engagement, Beharrlichkeit und Sichtbarkeit Wirkung haben, auch wenn es oft lange dauert.
Heißt also: Wandel ist möglich – aber nur, wenn man dranbleibt?
Tahir Della: Ja, genau. Veränderungen brauchen Zeit, besonders, wenn es um Strukturen geht, die über Jahrhunderte gewachsen sind. Und sie brauchen die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, auch innerhalb der eigenen Communitys oder Organisationen. Wir dürfen uns nicht nur als Opfer sehen, sondern müssen Verantwortung übernehmen und aktiv daran mitarbeiten, die Gesellschaft zu gestalten, die wir haben wollen.
Das gilt für alle, auch für Organisationen, die sich für Menschenrechte und Antirassismus einsetzen. Keine Struktur ist fehlerfrei, weder die ISD, noch die Amadeu Antonio Stiftung, noch andere. Wichtig ist, selbstkritisch zu bleiben und trotzdem an einer gemeinsamen Vision festzuhalten: eine Gesellschaft, die nicht von Rassismus, Ausschlüssen und Vorurteilen durchdrungen ist.
Ich finde, das ist uns bei der ISD oft ganz gut gelungen, auch wenn es manchmal mühsam ist. Und ja, es stimmt: Es fühlt sich oft an wie zwei Schritte vor, drei zurück. Gerade im Moment haben wir wieder eine Phase, in der vieles, was erreicht wurde, infrage gestellt oder sogar zurückgedreht wird. Nicht nur durch Kürzungen bei Förderungen, sondern auch durch veränderte gesellschaftliche Debatten.
Wie gehst du mit dieser Rückwärtsbewegung um?
Tahir Della: Wir sehen jetzt Menschen an Schlüsselpositionen, die Diskussionen neu aufrollen, von denen wir dachten, sie seien längst abgeschlossen. Und das ist frustrierend. Aber es ist auch ein Weckruf: Wir müssen mehr werden, mehr Mitglieder, mehr Aktive, mehr Stimmen mit unterschiedlichen Perspektiven. Wir müssen jüngere Menschen erreichen und sie ermutigen, sich einzubringen – kurz, wir müssen Widerstand organisieren.
Für mich ist das keine Resignation, sondern ein Aufruf: weiterzumachen, breiter aufzustellen, stärker zu werden.
Es geht also darum, Communitys zu stärken und Solidarität lebendig zu halten?
Tahir Della: Ja, absolut. Selbst wenn vieles gerade schwieriger wird oder unter Kürzungen leidet, es bleibt unabdingbar, diese Arbeit fortzusetzen. Politische Arbeit darf nicht abhängig sein von Staatlicher Förderung – so sinnvoll das ist.
Ich bin da trotz allem hoffnungsvoll, weil die Zivilgesellschaft in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel den USA, viel stärker ist, als wir oft denken. Und das gibt mir Mut.