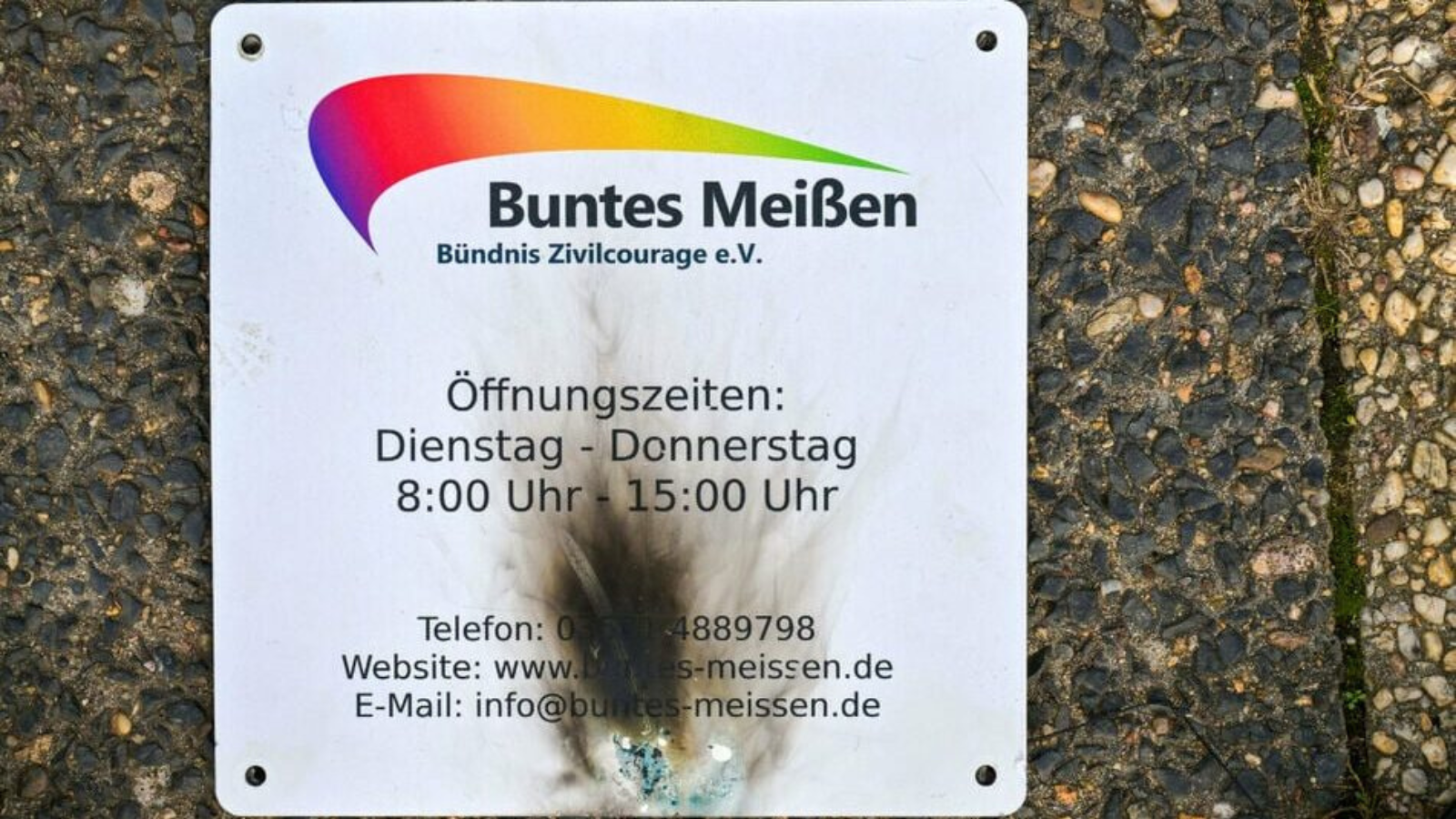İbrahim Arslan ist Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln im Jahr 1992. Als Siebenjähriger überlebte er nur knapp und verlor bei dem Anschlag seine Schwester Yeliz Arslan, seine Großmutter Bahide Arslan und seine Cousine Ayşe Yılmaz. Als Aktivist und Botschafter für Demokratie und Toleranz engagiert er sich seit vielen Jahren in der Antirassismus-Arbeit, spricht bundesweit auf Veranstaltungen und in Schulen. Zudem veranstaltet er jährlich die Möllner Rede im Exil gemeinsam mit dem Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992. Mit uns spricht er über die Erinnerungskultur in Deutschland und darüber, wie Betroffene rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt zu starken Akteur:innen empowert werden können.
Von Hanna Kämmerer
Warum ist es so wichtig, die Namen der Betroffenen rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt in den Vordergrund zu stellen?
Bisher standen in den Medien immer die Täter:innen im Vordergrund. Ihre Namen wurden genannt, ihre Gesichter gezeigt, ihre Geschichten erzählt. Dadurch entsteht Nähe und es kann passieren, dass die Gesellschaft sich mit der Täter:innenperspektive identifiziert. Das müssen wir durchbrechen, indem wir die Namen der Betroffenen in den Vordergrund stellen und ihre Geschichten erzählen. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Aufmerksamkeit, Solidarität und Unterstützung auch dort ankommen, wo sie hingehören.
Dieses Jahr wurde die Möllner Rede im Exil durch Newroz Duman und Naomi Henkel-Gümbel unterstützt. Wie wichtig ist die Vernetzung und Solidarität mit anderen Betroffenen?
Die Vernetzung mit anderen Betroffenen ist extrem wichtig. Sich zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen bedeutet, dass wir uns gegenseitig empowern. Wir unterstützen einander, geben Wissen weiter und helfen anderen Betroffenen dabei, selbst aktiv zu werden. Und wir kämpfen gemeinsam, fordern die alte Erinnerungskultur heraus und schaffen gemeinsam eine neue, in der die Betroffenen selbst im Zentrum stehen.
Weshalb sind Räume, die von Betroffenen selbst gestaltet werden, wie die Möllner Rede im Exil oder die Initiative 19. Februar so wichtig?
In Deutschland wird das Gedenken von Institutionen vereinnahmt. Deutschland ist nicht Weltmeister der Gedenkkultur – ganz im Gegenteil, es wird extrem viel versäumt und über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden. Das ist keine Solidarität, sondern Image-Politik. In selbst gestalteten Räumen, die wir uns erst hart erkämpfen mussten, entstehen
Workshops, Interventionen und vor allem Empowerment-Prozesse. Betroffene können dort endlich gehört werden und auch ihre Symptome verlieren.
Wie können Angehörige und Betroffene rechter Gewalt unterstützt werden?
Das wichtigste überhaupt ist, dass man die Betroffenen fragt, sich mit ihnen solidarisiert und auf ihre Bedürfnisse und Forderungen eingeht. Was genau getan werden muss ist individuell, da betroffene Personen unterschiedliche Bedürfnisse und Forderungen haben. Eine wesentliche Frage, die man sich selbst stellen muss, ist: Beziehe ich die Betroffenen in meine Interventionen mit ein oder lasse ich sie außer Acht?
Du hältst unter anderem Zeitzeugengespräche und Workshops an Schulen. Welche Erfahrungen machst du dort?
Ich biete Einblicke in die Perspektiven von Betroffenen – diese in den Vordergrund zu stellen, die heutige Gedenkkultur zu hinterfragen und neue Erinnerungspraktiken zu entwickeln ist mir wichtig. Zudem gebe ich Schüler:innen die Möglichkeit, in einem geschützten Raum über ihre Rassismuserfahrungen zu sprechen und stoße Empowerment-Prozesse an. Ich will zeigen, dass Betroffene keine passiven Objekte, sondern handlungsfähige Subjekte sind. Opfer oder Betroffene zu sein heißt nicht, dass man schwach ist, sondern ganz im Gegenteil – sie sind stark und leisten Widerstand. Wir sollten in jeglicher Intervention im Hinterkopf behalten, dass Opfer und Überlebende keine Statist:innen sind, sie sind die Hauptzeug:innen des Geschehenes.