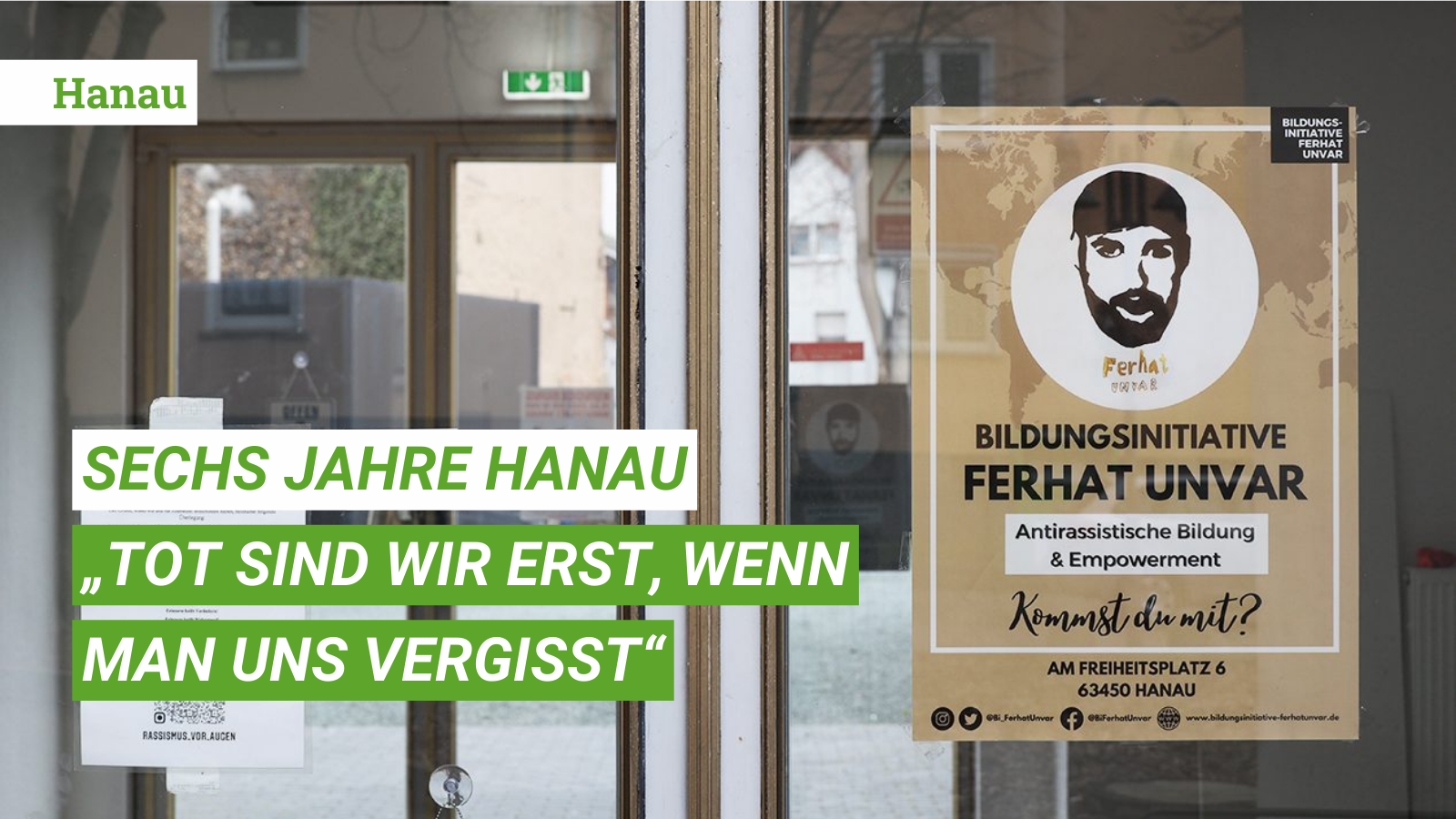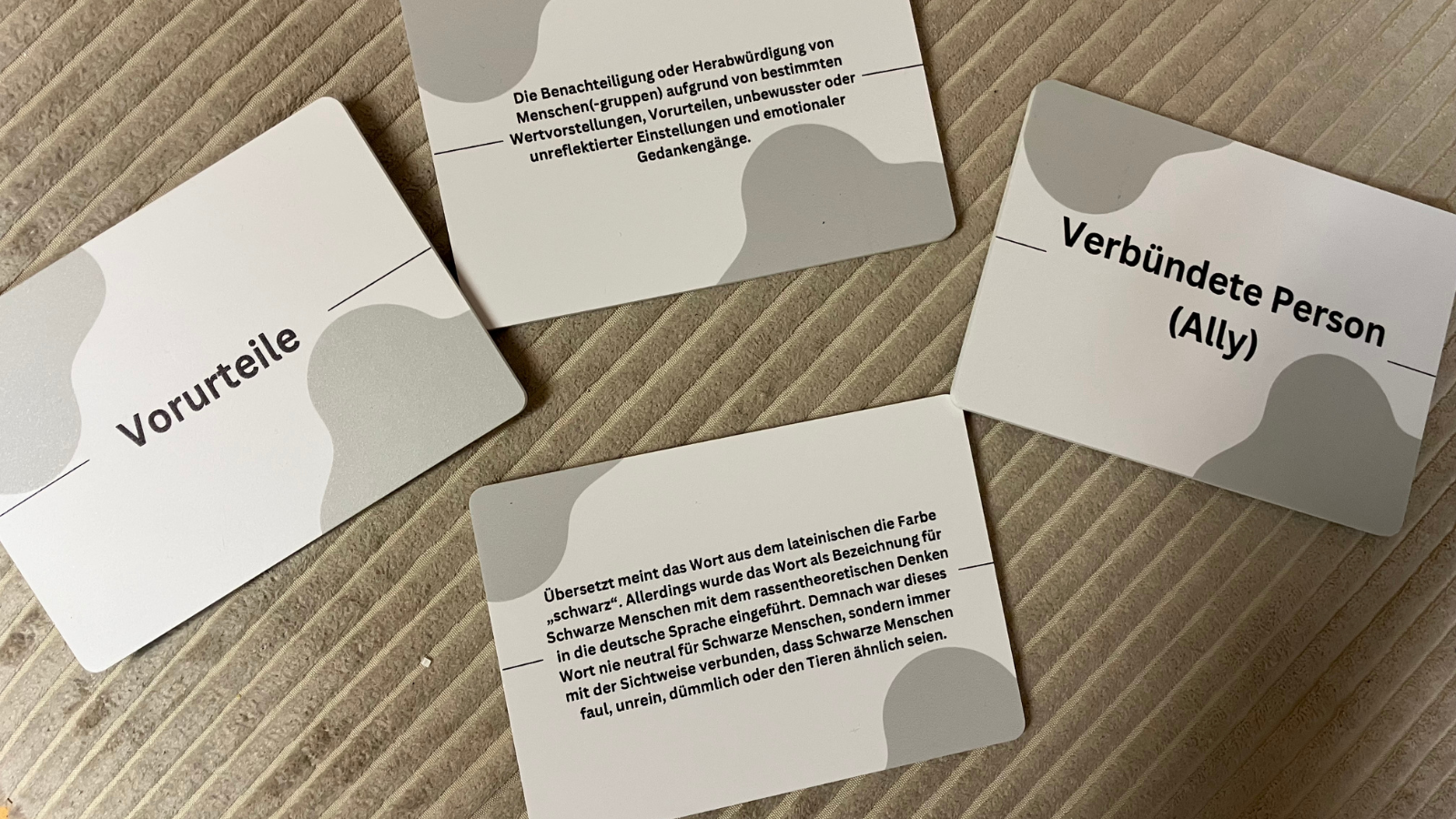Die Großfunkstelle im brandenburgischen Nauen ist die älteste aktive Sendeanlage der Welt. Mit ehemaligen Funkstationen in Togo und Namibia bildete sie im Deutschen Kaiserreich ein Funkdreieck kolonialer Kommunikation. Ein Audiowalk verbindet Menschen in Namibia und Deutschland live und zeigt, wie koloniale und rassistische Verstrickungen wirk(t)en.
Von Vera Ohlendorf
An einem grauen Sonntagnachmittag im August fährt ein Bus durch Nauen. Er bringt 20 Menschen aus Berlin zum Gelände der Großfunkstelle, die im Nordosten der Kleinstadt auf einem weiten Areal steht. Das Sendegebäude erhebt sich, flankiert von zwei riesigen Funkantennen, wie eine Kathedrale in den Himmel. Hier trifft die Gruppe auf 60 weitere Besucher*innen aus Nauen und Umgebung. Im Inneren des Gebäudes werden Kopfhörer verteilt. Die Gruppe teilt sich: 40 Besucher*innen nehmen zuerst am performativen Audiowalk „Space has become a crowded place #2“ teil, der zeitgleich und live über Funk verbunden auch in Windhoek mit einer ähnlich großen Gruppe stattfindet. Die übrigen Besucher*innen lassen sich durch Mitglieder des Nauener Heimatfreunde 1990 e.V. durch die Geschichte von Gelände und Funktechnik von 1906 bis heute führen. Später wird gewechselt. Der Audiowalk wurde von den Sound- und Performance-Künstler*innen Angelika Waniek, Nashilongweshipwe (Nashi) Mushaandja und Frederike Moormann entwickelt. Die Veranstaltung in Nauen, gefördert durch die Amadeu Antonio Stiftung, ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“ im Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte in Potsdam.
Kolonialgeschichte und Völkermord sind Leerstellen des kollektiven Erinnerns
Obwohl es sich bei der Großfunkstelle in Nauen um die älteste noch aktive Funkstation der Welt handelt und die Geschichte von Gelände, Sendeanlagen und Technik gut erforscht ist, blieben die kolonialen und rassistischen globalen Zusammenhänge bisher meist unerwähnt. Bei den regelmäßig stattfindenden Führungen der Heimatfreunde Nauen standen bisher technische Details im Vordergrund. Fotos und Videos der Funkstelle in Togo, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts für kurze Zeit bestand, wurden dabei unkommentiert gezeigt.
Die Telekommunikation spielte im deutschen Kaiserreich eine wesentliche Rolle als koloniales Machtinstrument. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten durch die drahtlose Telegrafie erstmals große Entfernungen ohne störanfällige Tiefseekabel überbrückt werden. Die Großfunkstelle Nauen wurde 1906 von der kaiserlichen Regierung mit dem Ziel errichtet, eine direkte Verbindung zu den deutschen Kolonien in Togo und im damaligen sogenannten Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) herzustellen. Bereits 1904 wurde während des Völkermordes an den Herero und Nama mobile Funktechnologie zur strategischen Informationsgewinnung eingesetzt. Mit dem Bau der Funkstationen in Windhoek und Kamina schuf die Firma Telefunken wenig später eine effiziente, weltumspannende Kommunikationsinfrastruktur, um militärische und wirtschaftliche Macht zur Unterdrückung der kolonisierten Bevölkerungen auszuüben. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 sprengten deutsche Truppen die Stationen in Kamina und Windhoek jedoch, um sie nicht in die Hände der Alliierten fallen zu lassen. Die Station in Nauen wurde hingegen weiter ausgebaut und etablierte sich während der NS-Zeit und in der DDR als eines der weltweit bedeutendsten Zentren für Funkkommunikation.
Ausbeutung und ökonomische Abhängigkeiten bestehen bis heute
Bis heute setzen sich koloniale Kommunikationsstrukturen fort, die sich etwa in ökonomischen Abhängigkeiten afrikanischer Staaten von globalen Satelliten-, Medien- und Kommunikationsstrukturen US-amerikanischer und europäischer Konzerne zeigen.
„Vor etwa sechs Jahren sind wir während einer anderen Recherche auf die Fotos der Funkanlagen aus Togo gestoßen“, erzählt Angelika Waniek. „Ich hatte das Gefühl, dies ist auch Teil meiner Geschichte, an die wir viel zu selten erinnern. Nur wenige Deutsche haben Wissen über die Geschichte der Kolonien und den Völkermord.“ So begann das Projekt, bei dem Künstler*innen aus Deutschland, Togo und Namibia eng zusammengearbeitet haben. Ziel war es, mit dem Audiowalk bisher ungehörte Perspektiven auf die Kolonialgeschichte hör- und sichtbar zu machen und öffentliches Erinnern in Brandenburg zu verändern. Aus neuen Arbeitskontakten wurden schnell Freundschaften. „Wir wollen in Brandenburg dafür sensibilisieren, dass koloniale Strukturen weiterbestehen. Es gibt bis heute ein Ungleichgewicht in der Frage, wem die für unsere weltweite Kommunikation so wichtigen Satelliten gehören und wo Menschen und Bodenschätze ausgebeutet werden, um diese Satelliten zu bauen“, beschreibt Angelika Waniek weiter. In Windhoek, wo der Audiowalk zeitgleich stattfindet, sei die Geschichte der ehemaligen Funkstation, ähnlich wie in Togo, ebenfalls kaum bekannt. Dort gehe es darum, durch gemeinsames Erinnern kollektive koloniale Traumata bewusst zu machen und Heilung zu ermöglichen.
Audiowalk verbindet Windhoek und Nauen
Der Audiowalk startet am Bahnhof in Windhoek, der während der Kolonialzeit und der darauffolgenden Zeit der Apartheid unter südafrikanischer Herrschaft logistische Bedeutung hatte. In Nauen führt der Weg zeitgleich aus der Sendehalle durch das Materiallager nach draußen:
„Afrikaner*innen in Zentral- und Südnamibia rebellierten gegen die deutsche Kolonialverwaltung, nachdem ihr Land […] gewaltsam besetzt worden war. Die Afrikaner*innen verloren ihr Land und ihr Vieh und wurden daraufhin in die Wüsten Namib und Kalahari getrieben, wo sie an Dehydrierung und Hunger starben. Ovaherero, Nama und San, die diesen Völkermord überlebten, wurden in Lager gesteckt […], und als Sklavenarbeiter*innen zur Unterstützung der Kolonialwirtschaft eingesetzt. Bis 1908 wurden 24.000 bis 100.000 Ovaherero und 10.000 Nama getötet, was schließlich als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts anerkannt wurde.“ (Nashi Mushaandja, Audiowalk)
Die Teilnehmenden in beiden Ländern erfahren über Kopfhörer, wie die Ausbeutung afrikanischer Kupferminen die technologische Entwicklung befeuerte, die wiederum für effizientere Ausbeutung und Unterdrückung eingesetzt wurde. In Windhoek führt der Weg von einer Kudu-Statue, dem Wahrzeichen der Stadt, zum Hauptsitz der Telecom Namibia. In Nauen spazieren 30 Besucher*innen über eine große Brachfläche, an einer Schafherde vorbei.
Der Audiowalk kontrastiert „rationale“ Technologiebeschreibungen eines Mitarbeiters der Europäischen Weltraumbehörde ESA mit Erzählungen über traditionelle namibische Kommunikation mit Vorfahren und Geistern. Wie lässt sich Fernes anrufen, wie rücken weit auseinanderliegende Orte zusammen? Eine universelle Frage, die sich zu allen Zeiten in allen Teilen der Welt stellt.
„Mit dem Kudu-Horn rufst du die Ahnen, der Klang ist mit dem Geist verbunden. Er verändert alles. Er verändert alles. Wenn ich in deinen Kopf, in deinen Geist blase, bist du mit etwas verbunden.“ (West Uarije, Audiowalk)
In Windhoek laufen die Teilnehmenden durch einen Park, in dem ein mit einem Adler verziertes imperialistisches Denkmal für die gefallenen deutschen Soldaten steht, das irgendwer mit „fuck Germany, rest in hell“ besprüht hat. In Nauen wird eine der beiden großen Antennen umrundet. Alle hören ein Gedicht über den namibischen Widerstandskämpfer und Feldherrn Hendrick Witbooi. In Windhoek führt der Weg dann zu einem Denkmal an den Völkermord. Zu hören ist für alle, wie sich Traumata generationenübergreifend vererben.
„Es gibt immer eine positive und eine negative Seite dieser Dinge, und im Weltraum ist das natürlich nicht anders.“ (Christopher Vasko, Audiowalk)
Wem gehört der Erinnerungsraum?
In Windhoek endet der Walk auf dem Parkplatz einer Schule, von dem man zum ehemaligen Standort der Funkstation sehen kann. Beide Gruppen werden mit musikalischen Interventionen empfangen, in Windhoek von West Uarije, in Nauen von Gundolf Nandico und Luka Mukhavele, die die große Sendehalle mit den Klängen von Vogelhorn, Mamba, Mbira, Mvoko und Kuduhorn erfüllen. Beschwören sie die Ahnen, die von den Folgen von Kolonialismus und Technologie betroffen und bisher in der Geschichte der Großfunkstelle unsichtbar waren oder wollen sie die Geister vertreiben? Das zu entscheiden bleibt den Besucher*innen überlassen. Nicht alle finden es gut, dass die parallele Führung der Nauener Heimatfreunde wegen der Musik vorzeitig enden muss. Es kommt am Rand zu einer hitzigen Diskussion und zu rassistischen Äußerungen. Es ist nicht für alle leicht, sich mit der deutschen Kolonialgeschichte und ihren Folgen konfrontiert zu sehen.
„Andere, uns vielleicht unbekannte Perspektiven auf unsere Geschichte und Realität sind immer vorhanden. Wir haben uns gefragt, wie die verschiedenen Perspektiven in Dialog kommen können“, beschreibt Frederike Moormann. „Mündliches Erzählen ist wichtig, jenseits von Aktenarchiven. Über mündliches Erzählen kommt ein musikalisches Moment in die Geschichte. Durch Musikalität und Sound können wir Dinge über die Sinne verstehen. Wir sollten unsere eingeengte Sicht auf Technologieentwicklung aufbrechen“, sagt sie.
Der Audiowalk wird in Windhoek noch öfter stattfinden, das Interesse ist groß. In Nauen werden die Tafeln der bisherigen Dauerausstellung im Sendegebäude durch einen QR-Code zu einem Ausschnitt des Audiowalks und durch weitere Texttafeln erweitert, um den bisher eurozentrierten Erinnerungsraum um die Erzählung kolonialer Macht und ihrer Folgen zu erweitern. Eine für das Radio angepasste Version des Audiowalks ist bei Deutschlandradio hier ab Minute 10:00 nachzuhören.