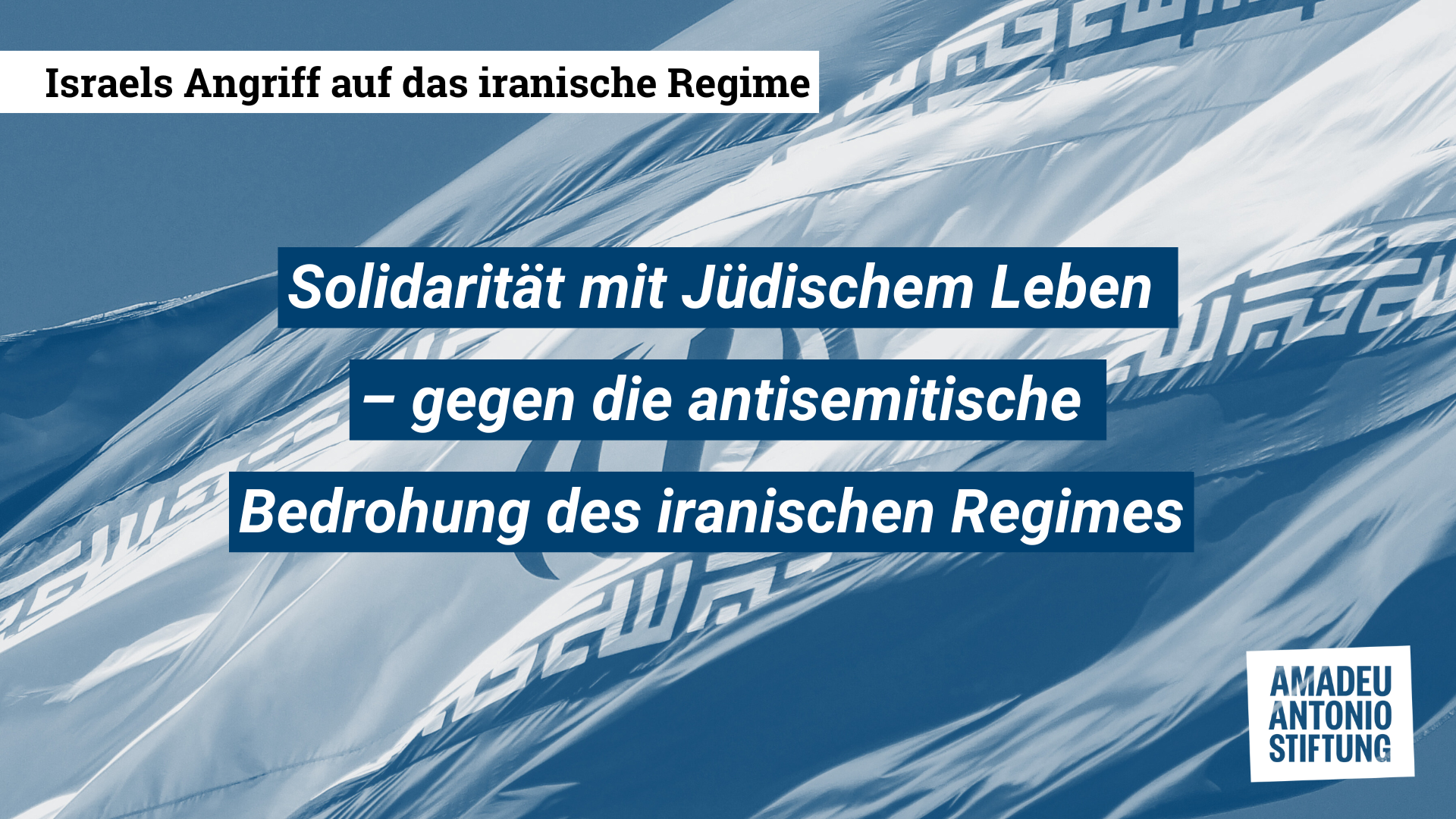In der Endersstraße in Leipzig-Lindenau klafft eine Lücke im Pflaster: Die Stolpersteine, die an Leon und Laura Kohs erinnern, fehlen. Sie wurden herausgerissen. Was bewegt Menschen dazu, Stolpersteine zu stehlen?
Am 27. Januar 2025 jährt sich der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal. Seit 1996 ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein bundesweiter Gedenktag in Deutschland. In der Chronik antisemitischer Vorfälle der Amadeu Antonio Stiftung zeigt sich, dass dieses Gedenken ständig angegriffen wird, indem Stolpersteine geschändet und Hakenkreuze auf Erinnerungsorte geschmiert werden. Das Ziel ist es, die Namen aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen und die Erinnerung an die Shoah zu verunmöglichen – und all jene einzuschüchtern, die sich für eine Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten einsetzen.
Stolpersteine sind dezentrale Mahnmale, die an die Ermordung, Vertreibung oder Deportation von Menschen durch die Nationalsozialisten erinnern. Zu diesen Menschen zählen Jüdinnen*Juden, Sinti*zze und Rom*nja, Menschen aus dem politischen oder religiös motivierten Widerstand, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, körperlich und geistig Behinderte, nicht-weiße Personen, Prostituierte und Personen, die als „Asoziale“ verfolgt wurden, sprich soziale Minderheiten wie Obdachlose, „Arbeitsverweigerer“, Landstreicher und Bettler. Über 100.000 Stolpersteine wurden bereits in 21 europäischen Ländern verlegt, der überwiegende Teil davon in Deutschland.
Das Projekt „Stolpersteine“ der STIFTUNG – SPUREN – Gunter Demnig“ wurde vom Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufen. Alles begann Anfang der 1990er-Jahre. Zuerst markierte Demnig in Köln die Strecke, auf der die Nationalsozialisten die ersten Sinti*zze und Rom*nja ins Vernichtungslager trieben. 1992 verlegte er vor dem Kölner Rathaus den ersten Stein, der den Text des Auschwitz-Erlasses zur Deportation von Sinti*zze und Rom*nja trägt – damals noch ohne Genehmigung. Mit diesen beiden Interventionen im öffentlichen Raum entstand die Idee der heutigen Stolpersteine. Fünf Jahre danach folgten die ersten genehmigten Stolpersteinverlegungen.
Die Absicht hinter den Stolpersteinen ist es, die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus aufrecht zu erhalten und ihre Namen wieder ins Bewusstsein zu rufen. So werden diese Erinnerungsmahnmale vor dem zuletzt frei gewählten Wohnort der Betroffenen im Boden eingelassen. Stolpersteine sind Betonwürfel, auf deren Oberfläche eine 10 x 10 cm große Messingplatte mit abgerundeten Ecken angebracht ist. Auf dieser Platte stehen Vor- und Nachname der Person, der Geburtsname, das Geburtsjahr, das Deportationsjahr und deren Schicksal – sofern bekannt. Stolpersteine werden über Patenschaften finanziert, so kann jede*r aktiv einen Teil zur Erinnerungskultur beitragen.
Diebstähle und Beschädigungen von Stolpersteinen
Diese Interventionen im öffentlichen Raum bleiben nicht unbeantwortet. Deutschlandweit werden Stolpersteine seit Jahren immer wieder gestohlen oder beschädigt. In den häufigsten Fällen verlaufen etwaige Ermittlungen im Sande. Ein Teil der Vorfälle wird in der Chronik antisemitischer Vorfälle der Amadeu Antonio Stiftung gelistet. So wurden bereits im Januar 2024 drei Stolpersteine in Coppenbrügge mit schwarzer Farbe beschmiert, sodass deren Inschrift nicht mehr lesbar war. Die Stolpersteine erinnern an die jüdische Familie Adler – David und Resi sowie deren Sohn Martin. Ein ähnlicher Vorfall wurde in Essen einen Tag vor dem Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome entdeckt. Hier wurden sieben Stolpersteine mit roter Farbe besprüht. Diese erinnern an die jüdischen Familien Gelles und Weis – Rosa, David und Richard. Teilweise wurden in der Vergangenheit auf die Steine auch ätzende Flüssigkeiten gegossen, wie im Jahr 2023 in Aschaffenburg. In Weimar wurden neun der Erinnerungsmahnmale mit einer gipsähnlichen Masse bekippt, was die Reinigung umso schwieriger gestaltete.
In Weimar nutzte kurz nach dem 9. November ein Unbekannter in der Nacht einen Winkelschleifer, um die Inschrift eines Stolpersteins unkenntlich zu machen und flüchtete, als er von einer Anwohnerin auf die Tat angesprochen wurde. Eine andere Person versuchte in Berlin-Spandau einen Stolperstein vermutlich auszuhebeln, was ihr aber nicht gelang. Der Versuch führte zur Verbiegung der Messingplatte mit der Inschrift zur Erinnerung an die Jüdin Lore Pieck. Durch diese Taten werden Stolpersteine meist irreversibel beschädigt und müssen komplett ausgetauscht werden.
Das Ziel der Zerstörung von Stolpersteinen ist klar: damit wird die Erinnerung an die Personen verunmöglicht. Bis der Stein gereinigt, repariert oder ersetzt wird, verschwindet der Name – wenn auch nur für kurze Zeit – aus der Öffentlichkeit und somit aus der Erinnerung.
Häufig nutzen Täter*innen noch radikalere Methoden, indem sie Stolpersteine komplett herausreißen und stehlen. So wurden im Zeitraum von Ende Oktober bis Anfang Dezember 2024 Stolpersteine in Halle (für die jüdische Familie Brilling – Max, Anna, Bruno, Regina und Lieselotte), Oschersleben, Dresden (für die Jüdin Margarete Schreiber) und Krefeld (für die Jüdinnen*Juden Charlotte Steinberg, Werner Pappenheimer, Helmuth Pappenheimer, Hilde Pappenheimer, Eugen Hirtz, Simon Hirtz und Selma Hirtz) gestohlen. Kurze Zeit nach dem Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus wurden in der Kleinstadt Kierspe drei Stolpersteine zur Erinnerung an die Jüdinnen*Juden Heinrich und Bertha Rachel sowie Erich Hess aus dem Boden gerissen. Zwei der drei Steine wurden in unmittelbarer Nähe wiedergefunden, der Erinnerungsstein für Bertha Rachel verschwand spurlos.
Engagierte setzen sich für die Erinnerung an jüdisches Leben ein
Diese Taten stellen einen Angriff auf die Erinnerungskultur dar. Sie drücken den Wunsch der Täter*innen nach einem Ende des sogenannten „Schuldkults“ aus. Aber das Verschwinden der Namen aus der Öffentlichkeit ist nur von kurzer Dauer, denn es gibt viele Engagierte, die diesen Taten etwas entgegensetzen. Nicht nur finden rund um den 27. Januar und den 9. November Putzaktionen der Stolpersteine statt. Eine Anleitung zur Reinigung gibt es vom Projekt „Stolpersteine“ selbst. Der Diebstahl von zehn Stolpersteinen in Zeitz wurde mit einem Spendenaufruf beantwortet. Dabei kam wesentlich mehr Geld zusammen als benötigt wurde, um die gestohlenen Steine zu ersetzen. Also konnten weitere, neue Steine verlegt werden. Außerdem wurden Schüler*innen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Zeitz auf den Diebstahl aufmerksam und druckten kurzerhand mit dem 3D-Drucker neue Kunststoff-Steine, die übergangsweise in die leeren Löcher im Boden eingesetzt werden konnten.
Auch in Leipzig-Lindenau wurden Stolpersteine gestohlen, sie erinnern an Leon und Laura Kohs. Susanne Siegert vom Instagram– und TikTok-Format „Keine Erinnerungskultur“ erfuhr von dem Diebstahl über eine Polizeimeldung. Sie erklärt: Stolpersteine machen heute sichtbar, dass hier Jüdinnen*Juden gelebt haben. Jetzt klafft aber eine Lücke im Kopfsteinpflaster, eine Leerstelle, die die Erinnerung an das jüdische Leben hier unsichtbar mache. Nachdem kaum Medien über den Vorfall berichteten und die Stolpersteine weiterhin fehlten, druckte Siegert Bilder der Stolpersteine aus und legte sie auf die Löcher mit dem Hinweis auf den Diebstahl und den Namen der Opfer. Sie veröffentlichte ihr Engagement über Social Media, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Daraufhin meldeten sich mehrere Personen, die ihr anboten, mit einem 3D-Drucker die aktuell gestohlenen Steine – oder auch bei erneuten Vorkommnissen weitere – nachzudrucken. Wenige Tage später konnte sie zwei weiße, gut sichtbare gedruckte Steine im Boden einsetzen und die Lücke im Pflaster schließen. Die Anwohner*innen meinten zu Siegert: „Richtig cool, dass du das machst. Es hat mir jedes Mal einen Stich ins Herz versetzt, hier vorbeizugehen und zu sehen, dass die Steine fehlen.“

Siegerts Videos werden auf Instagram und TikTok viel geklickt. Sind auch Stolpersteine für eine junge Generation interessant? Siegert ist optimistisch: „Stolpersteine sind Formen der Erinnerung, die konkret am eigenen Wohnort und Alltag präsent sind. Dadurch fällt es leichter, ein aktiver Teil von Gedenken zu sein. Digitale Formate können keine Begegnung ersetzen, müssen aber ein Zusatzangebot sein.“
Diese wichtigen Aktionen aus der Zivilgesellschaft zeigen, dass den Taten etwas entgegengesetzt werden kann, um die Opfer des Nationalsozialismus nicht zu vergessen. Gunter Demnig begründet den Antrieb für sein Projekt aus einem passenden Talmud-Zitat: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“