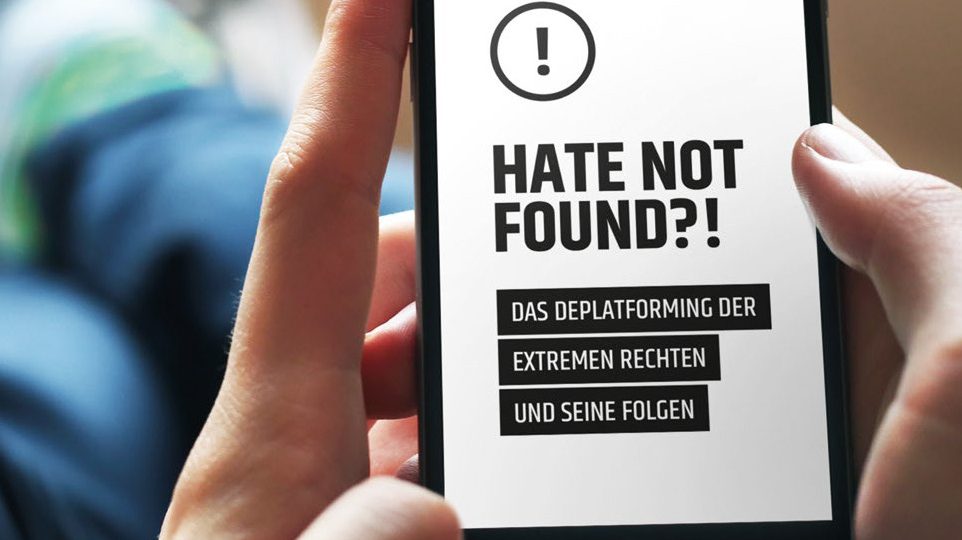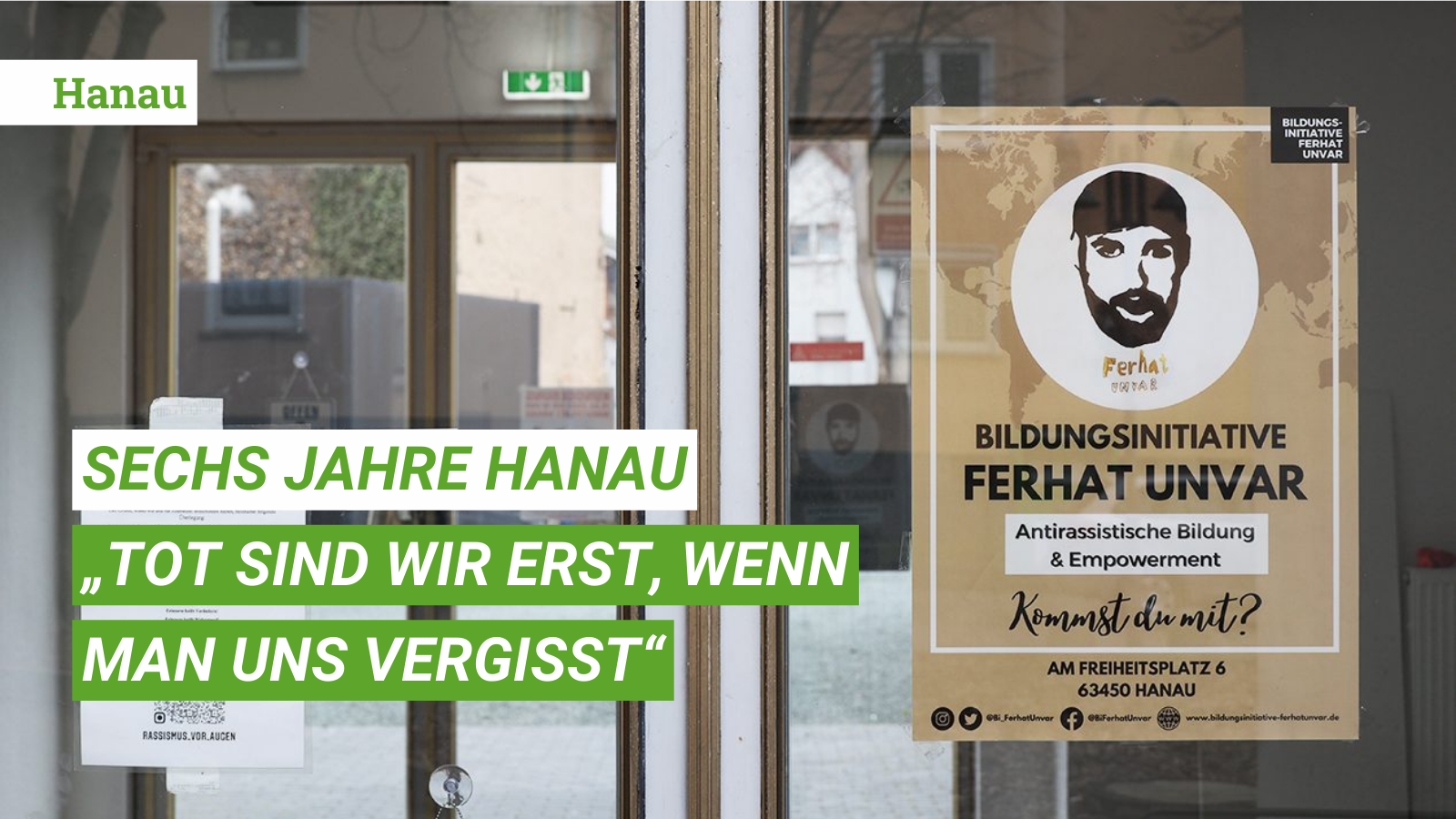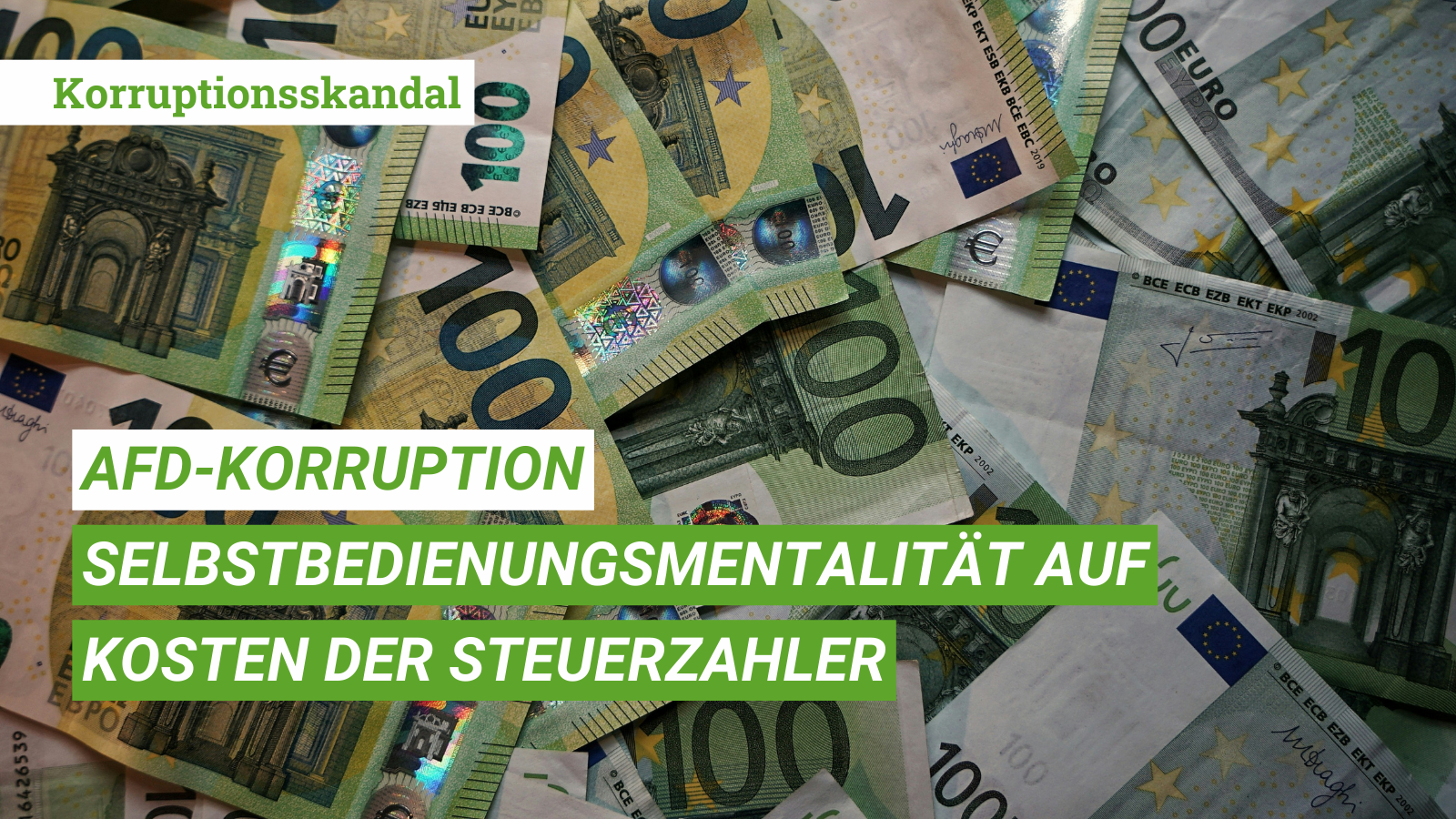“Hate not found?! Das Deplatforming der extremen Rechten und seine Folgen“ ist die erste systematische Studie zur Frage, wie sich Sperrungen von Profilen in den sozialen Medien auf die extreme Rechte im deutschsprachigen Raum auswirken.
Forscher*innen des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) aus Jena analysierten systematisch Muster in Kommunikations- und Verhaltensweisen, wenn Plattformbetreiber ihre Gemeinschaftsstandards gegen rechtsextreme Hassakteure durchsetzen. „Unser Fokus lag auf der Klärung der Fragen, welche Einschränkungen Hassakteure durch Löschungen hinnehmen müssen, welche innovativen Umgänge sie entwickeln, um kommunikativ handlungsfähig zu bleiben, und wie sie ihre Mobilisierung in sozialen Medien neu ausrichten“, stellt Maik Fielitz, Co-Autor der Studie, heraus.
Einschreiten der Plattformen schadet Rechtsextremen erheblich
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich Rechtsextreme von kommerziellen Plattformen abhängig gemacht haben und ihnen das Einschreiten der Betreiber erheblich schadet. Von 55 einflussreichen untersuchten Hassakteuren hatten 29 bereits digitale Plattformen verloren. Co-Autorin Karolin Schwarz erläutert: „Das Deplatforming zentraler rechtsextremer Akteure schränkt deren Mobilisierungskraft deutlich ein und nimmt ihnen eine zentrale Ressource, auf die ihre Inszenierungen abzielen: Aufmerksamkeit. In dieser Hinsicht lässt sich eindeutig sagen: Deplatforming wirkt.“
Die Studie kommt zu den folgenden Ergebnissen:
- Das Deplatforming zentraler rechtsextremer Akteure schränkt deren Mobilisierungskraft deutlich ein und nimmt ihnen eine zentrale Ressource, auf die ihre Inszenierungen abzielen: Aufmerksamkeit. In dieser Hinsicht lässt sich eindeutig sagen: Deplatforming wirkt.
- Repressive Plattformpolitiken treffen Hassakteure nicht mehr überraschend oder unvorbereitet. Im Gegenteil: Es bildeten sich innovative Muster des Umgangs heraus, die Handlungsfähigkeit signalisieren. Dazu gehören: semantische Mimikry-Taktiken, (Audio-)Visualisierung der Propaganda, Schaffung von Fake-Accounts, Einsatz von Proxies, Ausweichen auf Alternativplattformen sowie Aufbau eigener digitaler Infrastrukturen.
- Alternative Netzwerke werden genutzt, um Inhalte von gelöschten Akteuren wieder gezielt auf den großen Plattformen zu verbreiten. So navigieren Hassakteure ihre Follower*innen und Inhalte plattformübergreifend.
- Telegram hat sich zum zentralen Medium unter Hassakteuren entwickelt: 96% aller von uns untersuchten Hassakteure haben hier (hyper-)aktive Kanäle. Die meisten verstehen Telegram als ihre kommunikative Basis. Was dieses hybride Medium besonders macht: Es gibt so gut wie keine Moderation der Betreiber, Push-Nachrichten auf das Handydisplay wirken unmittelbarer und es kann leicht zwischen privater Messengerfunktion und öffentlicher Kanalfunktion gewechselt werden.
- Der Rückzug auf Alternativplattformen kann die Löschung aus dem digitalen Mainstream nicht ausgleichen. Abgesehen von Telegram haben sich keine stabilen Ausweichforen etabliert. Auf den bestehenden Alternativplattformen können rechtsextreme Ideen nicht effektiv zirkulieren, da sie kaum von Nutzer*innen aus dem deutschsprachigen Kontext frequentiert werden.
- Um nicht-intendierte Folgen des Deplatformings zu vermeiden, zum Beispiel die Steigerung von Aufmerksamkeit und der Bedeutung der Akteure, müssen Maßnahmen besser abgestimmt, deutlicher kommuniziert und unabhängig von politischen Kräfteverhältnissen durchgesetzt werden.
Die Studie wird gefördert von Facebook Deutschland. Der ausführliche Forschungsbericht findet sich unter https://www.idz-jena.de/hatenotfound/.