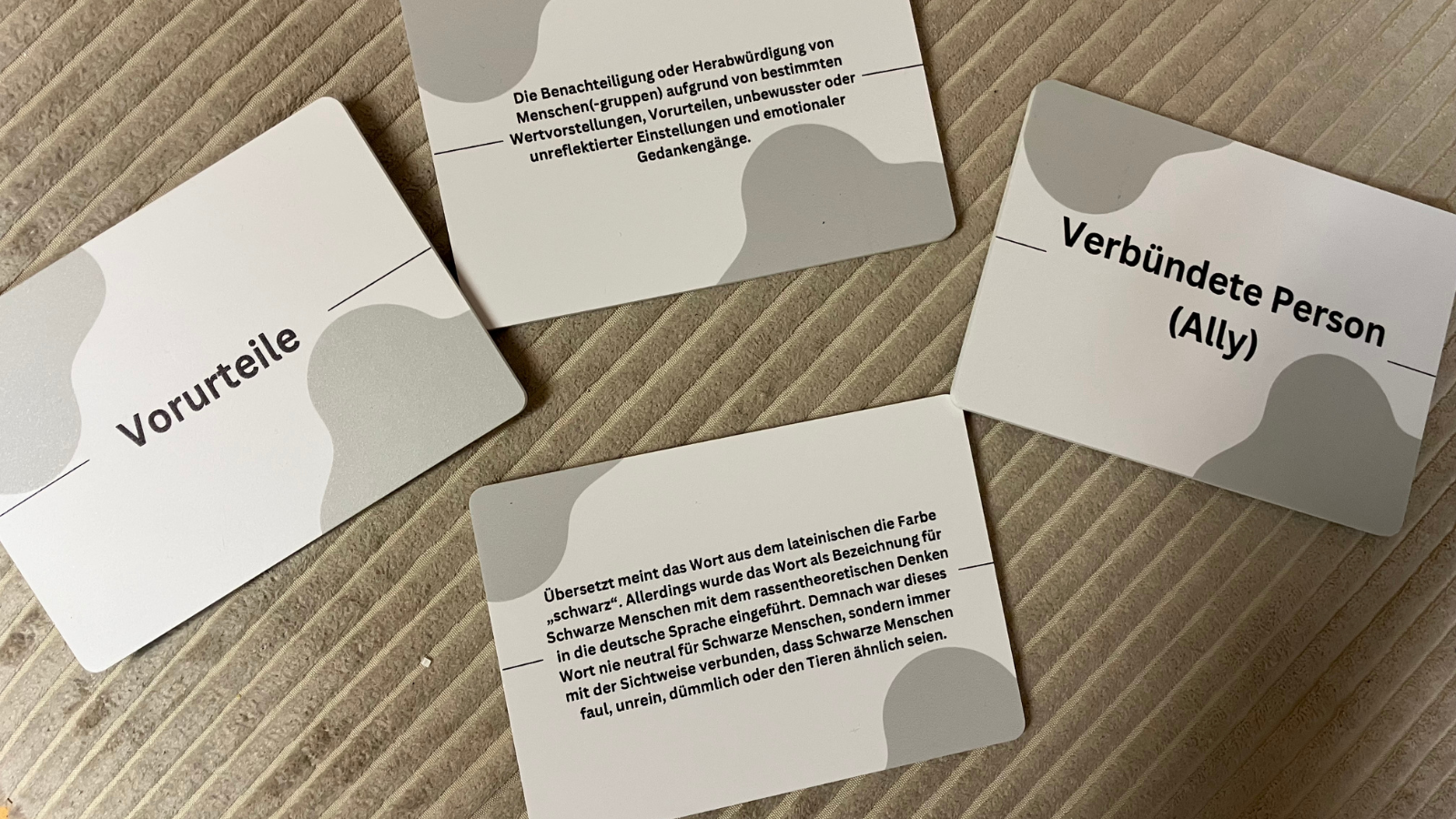Was hat Medizinische Versorgung mit Rechtsextremismus zu tun? Auf den ersten Blick scheinbar wenig, doch fragt man die Engagierten der sogenannten Medibüros, wird schnell klar, dass beide Dinge untrennbar zusammengehören. Auf einem von der Stiftung ermöglichten Vernetzungstreffen setzen sich die Ehrenamtlichen damit auseinander.
In immer mehr Städten gründeten sich bundesweit in den letzten 20 Jahren Anlaufstellen für Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Unter dem Label „Medibüro“, „Medizinische Flüchtlingshilfe“ oder „Medinetz“ kümmern sich Ehrenamtliche um einen regelmäßigen Zugang zu medizinischer Versorgung nicht nur für sogenannte „Illegale“, also Menschen ohne Aufenthaltsstatus und Papiere. Es sind immer mehr Menschen betroffen, die zwar hier leben und einen legalen Aufenthaltstitel haben, denen aber grundlegende soziale Rechte dennoch verwehrt werden.
Medibüros als Antwort auf Rassismus und Gewalt
Die ersten Medibüros entstanden Mitte der 1990er Jahre als Reaktion auf die starke Zunahme rassistischer Einstellungen und Gewalttaten. Zu jener Zeit wurde durch die Abschaffung des Asylrechts der Rassismus förmlich institutionalisiert. Fortan stellte sich die Frage, wie Gesundheitsversorgung in der Illegalität organisiert werden kann. 20 Jahre später haben die Medibüros schon viel erreicht. Ein breites Netzwerke aus Initiativen und Organisationen setzt sich für die Belange von Menschen ohne Papiere ein und die Arbeit im Verborgenen ist kaum mehr notwendig. Längst sind sie zu gefragten Experten geworden, deren Engagement gelobt wird.
Und doch hat sich an der alltäglichen Auseinandersetzung der oft ehrenamtlich Engagierten mit der allgegenwärtigen Ausgrenzung ihrer Klienten wenig geändert. Im Gegenteil: die Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus wird für die Engagierten immer wichtiger. Die aktuellen Krisenentwicklungen verschärfen den Konflikt um den Ausschluss aus sozialen Sicherungssystemen – und damit der medizinischen Grundversorgung noch zusätzlich. Und auch rassistische Ressentiments und die Anfeindung von sozialen Randgruppen, die vermeintlich auf Kosten der Allgemeinheit leben würden, nehmen immer stärker zu.
Veränderte Herausforderung Rassismus und Rechtsextremismus
Die Medibüros müssen bundesweit auf diese Entwicklung reagieren und treffen sich daher zu einem viertägigen Vernetzungstreffen in Hamburg. Mit finanzieller Förderung der Amadeu Antonio Stiftung konnte ein überregionales Treffen in Hamburg organisiert werden, das viel Zeit und Raum lässt, die inhaltliche Arbeit nach Gesichtspunkten der Rassismus- und Rechtsextremismusprävention auszurichten. In Workshops erfahren die Engagierten, welchen Diskriminierungen ihre Klientinnen und Klienten ausgesetzt sind und welche Interventionsfelder sich den Medibüros bieten. Das Beratungsangebot soll um Gegenstrategien erweitert werden und auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen diesbezüglich verbessert werden.
Wir freuen uns, diesen notwendigen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und wünschen der so wichtigen Arbeit der Medibüros eine weiter erfolgreiche Zukunft!
Kongress und Vernetzungstreffen „Gesundheit ist politisch! – Vom Medibüro zur Poli(t)klinik“ finden vom 17. bis zum 20 Mai statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des ausrichtenden Medibüros Hamburg.