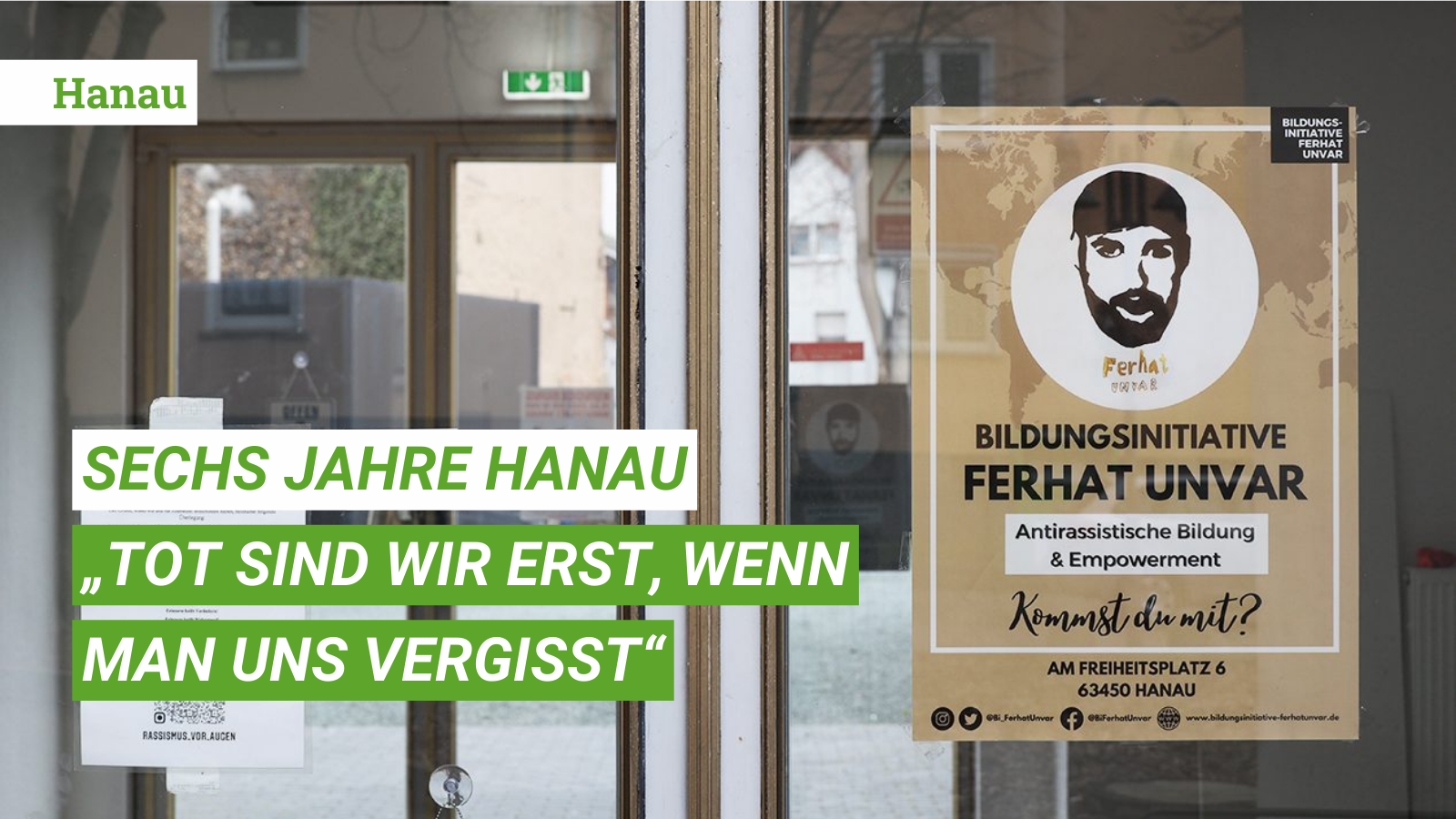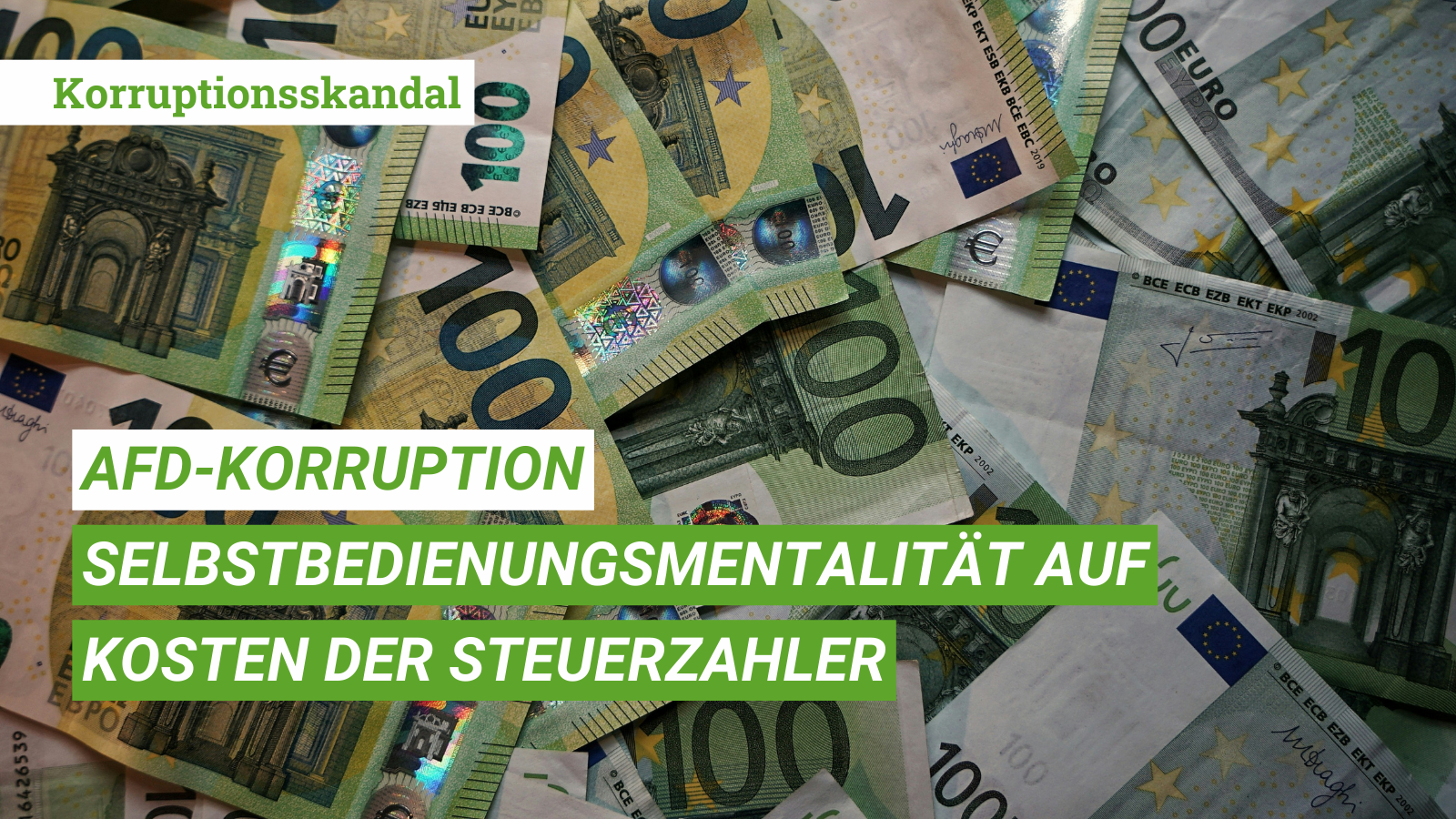„Auch 20 Jahre danach gibt es noch viele Leerstellen“, so Thomas Prenzel von der Uni Rostock. Er ist einer der Wissenschaftler, der mit Unterstützung der Amadeu Antonio Stiftung eine Studie über den Kontext, die Dimensionen und die Folgen der rassistischen Gewalt des Pogroms in Rostock Lichtenhagen im August 1992 herausgegeben hat. Nach seiner Einschätzung wurde der Brandanschlag auf die Unterkunft von Asylsuchenden und dem Wohnheim von Vietnamesen zwanzig Jahre danach „verdrängt, relativiert und instrumentalisiert“.
Hierfür ist unter anderem die mangelhafte Gedenkkultur ein Zeichen. Es fehlen öffentliche Gedenkstätten oder Ausstellungen, vielmehr unterliegt das Gedenken an die Überfälle Phasen wie aktuell durch das Datum des 20. Jahrestages. Trotz der Vorhersehbarkeit und der Ankündigungen im Vorfeld der Eskalation hat bis heute von offizieller Seite keine juristische Aufarbeitung der Geschehnisse und des verheerenden Polizeieinsatzes stattgefunden. Auch die damalige Zielgruppe der Angreifer, die als «Zigeuner» bezeichneten Roma, fänden bis heute keine Stimme in der Öffentlichkeit, so Mitautor Roman Guski.
Einschränkung des Grundrechts auf Asyl
In der Studie wird ebenfalls auf den Zusammenhang der Ausschreitungen in Rostock und der anschließenden Einschränkung des Grundrechts auf Asyl im Bundestag wenige Wochen später aufmerksam gemacht. Die legalen Möglichkeiten zur Einwanderung wurden massiv beschränkt. Gleichzeitig veränderte die Zustimmung der SPD zu dieser Gesetzesänderung das Klima in der breiten Öffentlichkeit. Rostock-Lichtenhagen wurde zu einem Symbol der Diskursverschiebung im gerade wiedervereinten Deutschland.
Die Broschüre zum Herunterladen finden Sie hier
Von Beeke Melcher, 21. August 2012