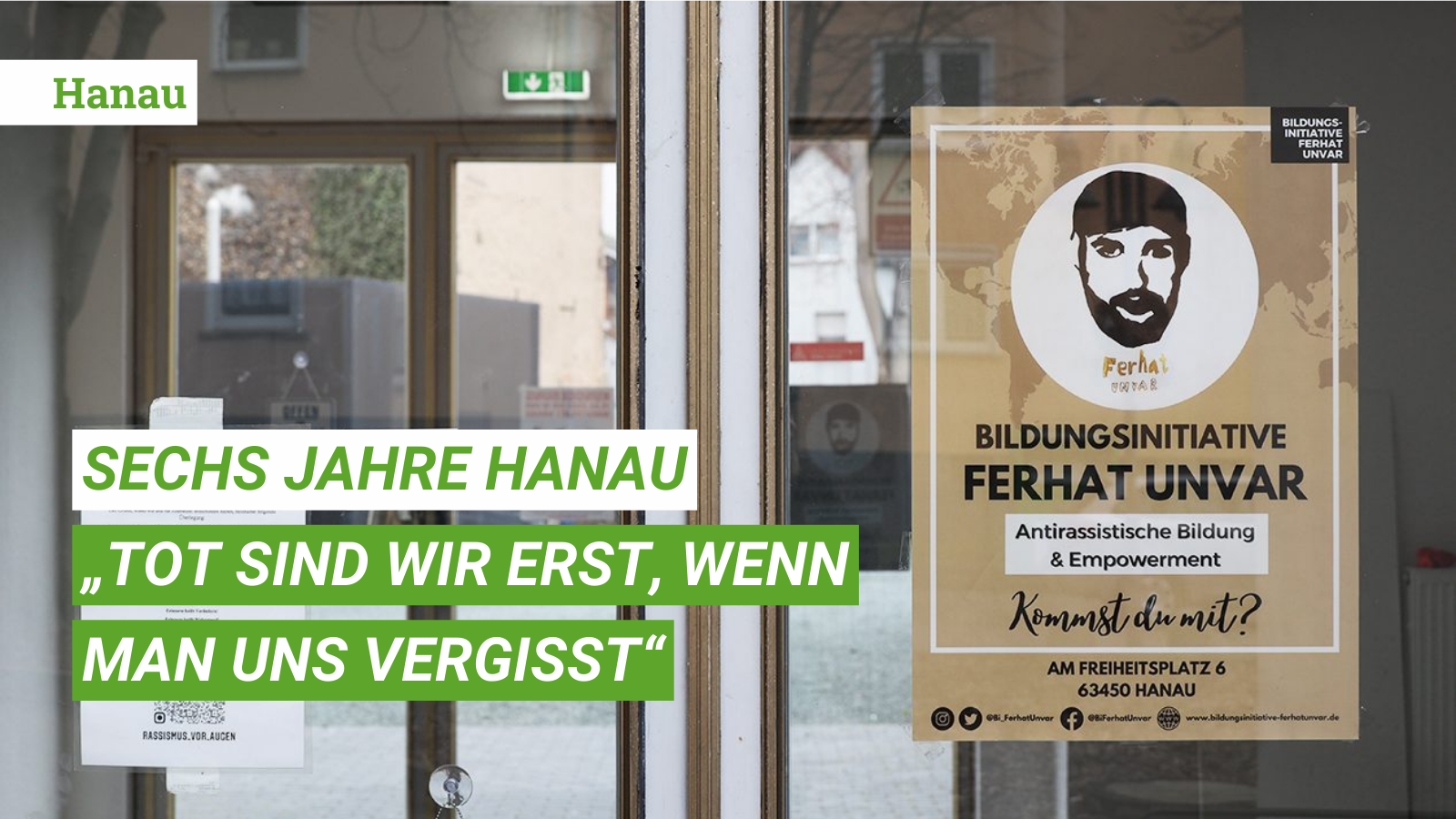Am 10. August 1975 jagten bis zu 300 DDR-Bürger*innen algerische Vertragsarbeiter durch die Erfurter Innenstadt und verletzten einige schwer. 50 Jahre später erinnerten Betroffene und Erfurter*innen an die Ereignisse. In der Öffentlichkeit spielt die Auseinandersetzung mit rassistischer Gewalt in der DDR weiterhin kaum eine Rolle. Die Auseinandersetzung mit rassistischer Gewalt findet auch Jahrzehnte später viel zu selten statt.
von Vera Ohlendorf
Hamdane kam 1975 mit Anfang 20 als Vertragsarbeiter nach Erfurt, blieb bis 1979 und ist nun für eine Gedenkveranstaltung zurückgekehrt. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Kollegen Ali und Manaa spricht er als Betroffener der Hetzjagd vor 50 Jahren zu den knapp 70 Personen, die sich am 10. August 2025 auf dem Domplatz versammelt haben. Die Erinnerungen an Rassismus und Gewalt wühlen ihn bis heute sichtlich auf: „In jedem Menschen gibt es Schmerzen und Opfer, die niemals ausgelöscht sind. Narben, die niemand geheilt hat. Gefühle, die niemand verurteilen kann. Weil niemand mit denselben Tränen geweint und mit demselben Schmerz gelitten hat. Jeder von uns weiß, was in seinem Herzen verschlossen ist.“
Die Perspektive der Betroffenen sichtbar machen
Insgesamt kamen zwischen 1974 und 1984 über 8.000 fast ausschließlich männliche Vertragsarbeiter aus Algerien in die DDR. Die meisten wurden im Bausektor und in der Braunkohleindustrie eingesetzt. 300 von ihnen lebten und arbeiteten in Erfurt. Hamdane, Manaa und Ali leisteten im Straßen- und Tiefbau-Kombinat und im Wohnungsbaukombinat schwere körperliche Arbeit. Als Kind hatten sie den algerischen Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich miterlebt und ihre Väter oder Brüder verloren. Sie kamen wie die anderen Algerier auch mit der Hoffnung auf gute Bezahlung und eine fundierte Ausbildung in die DDR. Die Realität sah anders aus: Sie erhielten zunächst weniger Lohn als ihre deutschen und osteuropäischen Kollegen, die Ausbildungsangebote fanden nach langen Arbeitstagen in den Abendstunden statt. Immer wieder kam es deshalb zu Streiks. Die meisten Vertragsarbeiter waren in beengten Wohnheimen untergebracht. Die Regierung wollte den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung möglichst verhindern. Maßnahmen zur Integration waren nicht vorgesehen.
Da die meisten Algerier nach vier Jahren Vertragslaufzeit nach Algerien zurückkehren mussten, sind ihre Perspektiven bisher kaum erforscht. Jan Schubert und Agnès Arp von der Oral-History-Forschungsstelle der Universität Erfurt schließen diese Leerstellen im Rahmen des Projektes „Algerische Arbeitsmigranten in der DDR“ und führten erstmals lebensgeschichtliche Interviews mit ehemaligen algerischen Vertragsarbeitern und weiteren Personen aus deren Umfeldern durch. Neben vielen anderen Themen spielt die Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Rassismus in der DDR im Rahmen der Forschungen und der Interviews eine wichtige Rolle.
Die meisten jüngeren Erfurter*innen wissen heute so gut wie nichts über die pogromartige Hetzjagd und weitere Ausschreitungen, die sich über drei Tage vom 10. bis zum 13. August 1975 zogen. Ältere Erfurter*innen reproduzieren nicht selten rassistische und sexistische Narrative und zeigen wenig Empathie mit den Betroffenen. Über Jahrzehnte hinweg gab es keine Erinnerungsarbeit in der Stadt. Die Wissenschaftler*innen aus Erfurt haben in diesem Jahr die erste Gedenkveranstaltung und begleitende Podiumsdiskussionen mit Betroffenen organisiert und wurden dabei durch die Thüringer Landeszentrale für politische Bildung, die Amadeu Antonio Stiftung und viele weitere Akteur*innen unterstützt.
Pogrom mit Vorgeschichte
Rassismus und nationalistische Einstellungen waren in der DDR verbreitet. Regierung und Medien idealisierten die „Völkerfreundschaft“ und betonten die Solidarität der Bevölkerung gegenüber den Vertragsarbeitern, die die DDR auch aus weiteren sozialistischen Staaten anwarb. Rassismus galt offiziell als Problem des kapitalistischen Westens. Eine fundierte Auseinandersetzung, etwa auch mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust, fanden nicht oder nur einseitig statt.
Das Baukombinat Erfurt verteilte 1974 eine „Aufklärungsbroschüre“ über die algerischen Arbeiter, in denen sie ihnen „rückständige Lebensweise“, Leistungsunwillen und eine Vorliebe für „12- bis 14-jährige Mädchen“ andichteten. Feindbilder und Stereotype wurden so offiziell gefestigt. In den Wochen vor dem 10. August 1975 waren wohl auch deshalb rassistische Gerüchte in Erfurt verbreitet. Den algerischen Vertragsarbeitern wurden Vergewaltigungen und Morde unterstellt. Laut Ermittlungen der Stasi wurden die Falschinformationen böswillig durch einzelne Akteur*innen in Umlauf gebracht. Keine dieser angeblichen Straftaten wurde jemals nachgewiesen. Am 10. August kam es auf dem Domplatz während eines Volksfests zu Auseinandersetzungen. Hamdane erinnert sich:
„Eine Gruppe junger Leute, die von irgendeinem bösen Geist aufgehetzt worden waren, wollte um jeden Preis eine Schlägerei mit uns anzetteln. Es begann mit Beleidigungen und Schimpfwörtern gegenüber unseren Freundinnen […]. Dann begannen sie, uns anzuspucken. Als wir nicht auf ihre Beleidigungen reagierten, schlug einer der jungen Männer einen Kollegen mit der Faust. Daraufhin schlug der Kollege mit dem Kopf zurück.“
Es kam zu einer Massenschlägerei. 25 Algerier wurden in der Folge von etwa 300 DDR-Bürger*innen über den Fischmarkt bis zum Hauptbahnhof gejagt. Die rassistischen Verfolger waren teils mit Eisenstangen und Latten bewaffnet, skandierten „Schlagt die Algerier tot“ und äußerten weitere Todesdrohungen. Die Volkspolizei setzte Hunde auch gegen die Algerier ein. Die Opfer wurden teils schwer verletzt. Hamdane versuchte, zu fliehen: „Als ich am Hauptbahnhof ankam, wollte ich ins Palastcafé gehen, aber dort wurde mir die Eingangstür verschlossen. Ich war in einer ausweglosen Situation. Die Meute trieb mich in die Enge und durch die Schläge verlor ich das Bewusstsein. Gegen Mitternacht wachte ich in einer Klinik in Erfurt-Nord auf.“ Auch Ali erzählt im Rahmen der Gedenkveranstaltung von seinen Erfahrungen an diesem Tag: „Am Bahnhof fand ich mich von sehr aggressiven jungen Männern umzingelt, die mich fast gelyncht hätten. Wenn die Algerier Manaa und Abbas nicht eingegriffen hätten, wäre ich nicht mehr am Leben.“
Zwei Tage später wurden algerische Arbeiter erneut in der Innenstadt durch 150 überwiegend junge Männer angegriffen und verfolgt. Erst am 13. August 1975 gelang es der Polizei, die Lage zu beruhigen, nachdem zuvor ein Wohnheim der Algerier von einem weiteren mit Stöcken bewaffneten Mob belagert und bedroht worden war. Viele Algerier verweigerten in den folgenden Tagen die Arbeit und nahmen nicht an den Ausbildungen teil. Im Anschluss kam es zu Ermittlungen der Behörden, die auch Gespräche mit den Betroffenen umfassten. Lediglich fünf der Täter wurden wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ zu Haftstrafen verurteilt.
Keine Aufarbeitung rassistischer Gewalt in der DDR
In den Medien wurden die Ereignisse am Rande erwähnt und als „Rowdytum“ verharmlost, Rassismus und Gewalt wurden nicht benannt. Annegret Schüle, Leiterin des „Erinnerungsorts Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz” geht in ihrem Redebeitrag während der Gedenkveranstaltung auf die sexistischen Anteile der rassistischen Diskurse ein, die zu der Hetzjagd führten: „‚Sie nehmen uns die Mädchen weg‘ war die Behauptung, die in diesen Tagen in Erfurt kursierte. Wegnehmen kann man nur etwas, das jemandem gehört. Die jungen Frauen, um die es ging, wurden also zum Eigentum der Männer erklärt. Eine eigene Entscheidung, welchen Männern sie sich zuwenden wollen, wurde ihnen von ihren patriarchalen, deutschen Zeitgenossen verwehrt.“ Einige der festgenommenen Männer gaben 1975 zu Protokoll, sie hätten ihre „Männlichkeit“ beweisen wollen. Bis heute kursieren in Erfurt Gerüchte über die angebliche sexuelle Devianz der „Fremden“. Sie werden in rassistischen und migrationsfeindlichen Narrativen der Gegenwart weltweit immer wieder neu reproduziert.
Die Erfurter Hetzjagd gilt als erster rassistischer Pogrom in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Rassistische, antisemitische und weitere rechtsextrem motivierte Straftaten waren in der DDR aber nicht so selten, wie es der SED-Regierung wohl lieb gewesen wäre. In den letzten Jahren hat der Historiker Harry Waibel anhand von Stasi-Unterlagen und anderen Archivdokumenten mehr als 700 rassistische und rechtsextreme Angriffe mit mindestens 12 Todesopfern in der DDR recherchiert. Immer wieder waren Vertragsarbeiter*innen betroffen, etwa aus Polen, Algerien, Vietnam, Mosambik, Ungarn und weiteren Ländern. Zu Ermittlungen oder gar Verurteilungen kam es nur selten. Die Straftaten werden bis heute meist nicht öffentlich thematisiert. 2025 wird in Merseburg den Opfern einer weiteren rassistischen Hetzjagd gedacht. Am Abend des 12. August 1979 kam es vor einer Disko zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Stein- und Flaschenwürfen zwischen kubanischen Vertragsarbeitern und DDR-Bürger*innen. Die Kubaner Delfín Guerra und Raúl García Paret ertranken kurz darauf in der Saale. Die genauen Umstände sind bis heute ungeklärt, strafrechtliche Maßnahmen wurden nicht eingeleitet. Seit sechs Jahren erinnert die Initiative 12. August an die rassistische Gewalt in Merseburg. In diesem Jahr wurden zwei Gedenktafeln an die Opfer in der Stadt angebracht.

Kontinuitäten rassistischer und rechtsextremer Gewalt nach 1945 bis heute
Die rechtsextrem motivierten, rassistischen Ausschreitungen der 1990er Jahre in Hoyerswerda 1991 und Rostock-Lichtenhagen 1992 waren keine Einzelfälle. Sie haben ihre Vorgeschichte in zahlreichen ähnlichen Verbrechen vor Mauerfall und Wiedervereinigung, die bis heute kaum bekannt und mehrheitlich nicht aufgearbeitet sind. Rassistische, rechtsextreme und antisemitische Gewalt nimmt aktuell in Thüringen und bundesweit stark zu. Eine Vertreterin der Thüringer Beratungsstelle ezra betont in ihrem Redebeitrag, dass die meisten rassistischen Straftaten damals wie heute in den Straßen passieren und damals wie heute kaum öffentliche Aufmerksamkeit finden. Damals wie heute werden rassistische Motive häufig verharmlost und Täter*innen nicht oder nur milde bestraft. Die Perspektiven der Opfer finden mehrheitlich keinen Raum, viele von ihnen erleben eine Täter-Opfer-Umkehr durch Gesellschaft oder Behörden.
Solidarität und zerrissene Familien
Hamdane, Ali und Manaa sind nach fast 50 Jahren nach Erfurt zurückgekommen, um ein Zeichen gegen Rassismus gestern und heute zu setzen. Es ist ihnen wichtig, auch von der großen Solidarität der Vertragsarbeiter untereinander und von den vielen Erfurter*innen zu berichten, von denen sie Hilfe und Unterstützung bekamen. Die drei Männer verbinden neben den leidvollen Erfahrungen auch positive Erinnerungen mit der Stadt: „Es waren wunderbare Jahre bis auf dieses traurige Ereignis. Deutschland ist meine zweite Heimat geworden“, erzählt Ali.
Obwohl die DDR-Behörden die Vertragsarbeiter von der deutschen Bevölkerung segregieren wollten, ist es den Algeriern gelungen, viele Freundschaften zu schließen und Liebesbeziehungen zu führen: Ebenso wie die Streiks gegen geringe Entlohnung und schlechte Arbeitsbedingungen war auch das Widerstand gegen die ausgrenzenden und strukturell rassistischen Regeln. Viele algerische Vertragsarbeiter haben die DDR 1979 nicht freiwillig verlassen. Ihre Aufenthaltsgenehmigungen endeten gemäß dem Abkommen mit Algerien mit ihren Arbeitsverträgen nach vier Jahren. Einige mussten ihre Kinder und Freundinnen zurücklassen, die Bindungen brachen über die Jahre ab. Über das Projekt der Oral-History-Forschungsstelle konnten familiäre Kontakte in drei Fällen wiederhergestellt werden. Viele andere ehemalige algerische Vertragsarbeiter sind bis heute auf der Suche nach ihren erwachsenen Kindern in Deutschland, was durch restriktive Visa-Regelungen erschwert wird.
Aufarbeitungsprozesse stehen erst am Anfang
Gedenkveranstaltungen wie die in Erfurt und Merseburg sind wichtig, um die Kontinuitäten rassistischer und rechtsextremer Gewalt seit 1945 sichtbar zu machen. Nur wenn es gelingt, die Perspektiven Betroffener im kollektiven Gedächtnis zu verankern und erlittenes Unrecht zu entschädigen, besteht die Chance, menschenfeindliche Narrative zu brechen. In Erfurt fand das Gedenken in diesem Jahr leider ohne Beteiligung von offiziellen Vertreter*innen der Stadt Erfurt oder des Landes Thüringen statt. Auch dieser Umstand zeigt: Die Aufarbeitung von Rechtsextremismus und Rassismus in der DDR ist ein Prozess, der gerade erst beginnt. Solidarität mit den Opfern rassistischer Gewalt ist heute in vielen Fällen nicht selbstverständlicher als in den 1970er Jahren.
Der Artikel erschien ursprünglich bei Belltower.News.