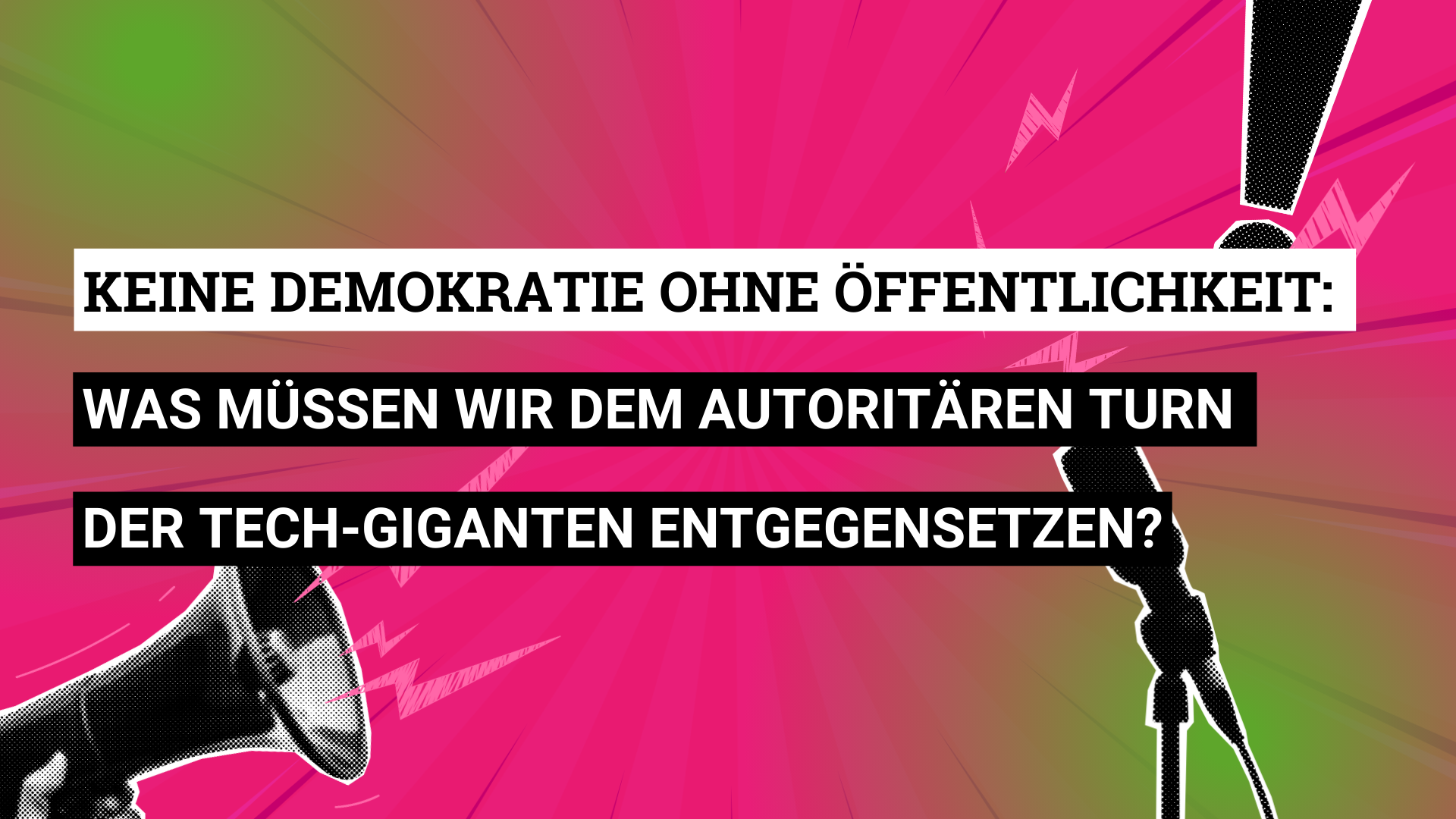Bald wird das NetzDG (2017, Deutschland) vom Digital Services Act abgelöst (Start 2024, EU). Dazwischen möchte das Bundesjustizministerium einen weiteren Gesetzesentwurf auf den Weg bringen, der die Opfer digitaler Gewalt unterstützen soll. Die Amadeu Antonio Stiftung nimmt Stellung zu den zentralen Maßnahmen im Eckpunktepapier.
Wer online beleidigt, beschimpft oder bedroht wird, muss feststellen: Mit der Strafverfolgung ist es aktuell noch so eine Sache. Oft genug werden Beleidigungen und Hate Speech wie Volksverhetzung nicht als solche (an-)erkannt. Falls doch, sind oft auch Daten, die zur Ermittlung der IP-Adresse nötig wären, die zum Täter führen könnte, schon gelöscht, bevor die Strafverfolgung beginnt. Daten werden von den Sozialen Netzwerken nicht herausgegeben und können somit nicht ermittelt werden. Für einen Rechtsstaat unbefriedigend.
Nun soll gegen Gewalt im digitalen Raum das „Gesetz gegen digitale Gewalt“, auch digitales Gewaltschutzgesetz, helfen, dessen erster Entwurf in Form eines Eckpunktepapiers nun vorliegt, und das bis 2024 verabschiedet werden soll. Darauf hatten sich SPD, Grüne und FDP schon in den Koalitionsverhandlungen geeinigt.
Die Amadeu Antonio Stiftung wurde gegründet, um solidarisch Opfern rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt zu helfen und um die Teile der Zivilgesellschaft zu stärken, die demokratische Werte leben wollen. Deshalb begrüßen wir die Idee hinter dem Eckpunktepapier für ein Gesetz gegen digitale Gewalt außerordentlich: Denn auch, wenn Deutschland eine Vorreiterrolle einnimmt bei den Bemühungen gegen Hass im Internet, haben die bisherigen gesetzgeberischen Maßnahmen sich mehr auf die Regulierung des Verhaltens sozialer Netzwerke konzentriert, aber weniger die Bedürfnisse von Opfern digitaler Gewalt in den Blick genommen. Es ist also aus unserer Perspektive sehr sinnvoll, wenn nun Opfern digitaler Gewalt geholfen und auch Strafverfolgungsmöglichkeiten gestärkt werden sollen.
Nun möchten wir zu den zentralen Maßnahmen im Eckpunktepapier Stellung nehmen.
1. Erweiterung des Anwendungsbereichs des Auskunftsverfahrens
Die Grundidee für eine Erweiterung des Auskunftsanspruchs meint etwas Begrüßenswertes: Wenn der Anfangsverdacht einer Rechtsverletzung besteht, sollen auf gerichtliche Anordnung IP-Adressen zu Accounts von Sozialen Netzwerken, Messengerdiensten und Kommunikationsunternehmen eingefroren werden, um Ausermittlung und Strafverfolgung sowie die Identifizierung von Täter*innen zu ermöglichen und Beweismittel für Gerichtsverfahren zur Verfügung zu stellen.
Irritierend ist hingegen die Ausweitung des Anwendungsfeldes des Auskunftsanspruchs: Statt ihn auf Fälle wie „Straftaten mit erheblicher Bedeutung“ (erster Entwurf des Bundesjustizministeriums zum Quick-Freeze-Verfahren) oder „schwerer Kriminalität“ (EU) zu konzentrieren, werden diverse Tatbestände der „rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte“ umfasst, was sehr weitreichende Rechte umfasst, die auch nicht unbedingt mit digitaler Gewalt zu tun haben. Dies könnte zu einer Einschränkung von Meinungsfreiheit führen, die vielleicht schwerwiegender sind als der Nutzen, wenn nicht der Anwendungsbereich des Auskunftsanspruchs genauer definiert wird.
Denn wenn etwa Unternehmen damit die Identität von Kritiker*innen ausfindig machen können, gefährdet das Whistleblower*innen oder anonyme Quellen in einem Maße, dass diese möglicherweise verstummen und Missstände bestehen bleiben. Auch könnten Rechtsextreme etwa über das Recht am eigenen Bild versuchen, an die Identität von politischen Gegner*innen oder journalistischen Recherche-Kollektiven zu kommen. Deshalb wäre es wünschenswert, das Auskunftsverfahren auf den Anfangsverdacht einer schweren Straftat zu begrenzen.
Es fehlt im Entwurf zudem ein Verfahren, wie sich beschuldigten Account-Inhaber*innen gegen unberechtigte Vorwürfe zur Wehr zu setzen und damit ihr Recht auf Meinungsfreiheit zu verteidigen können. Auch unberechtigte Vorwürfe können eine Strategie sein, um Menschen zu beschäftigen, finanziell zu schädigen und zum Schweigen zu bringen, die etwa die rechtsextreme Szene gern nutzt.
Nicht im Eckpunktepapier enthalten ist auch die Idee einer Login-Falle: Weil IP-Adressen veralten und gelöscht werden können, könnte ein Gericht auf Antrag Netzwerke verpflichten, bei einer künftigen Anmeldung eines Nutzers die aktuelle IP-Adresse an das Gericht zu melden, um Strafverfolgung zu ermöglichen.
2. Anspruch auf eine richterlich angeordnete Accountsperre
Die Grundidee für mögliche Account-Sperren anonymer Profile ist lobenswert: So soll – nach richterlicher Anordnung die Schließung notorischer Hass-Accounts ermöglicht werden, deren Inhaber*in nicht ermittelt werden kann.
Allerdings kommt in der Praxis weniger der im Eckpunktepapier entworfene Fall vor – eine Person wird von einem Account mehrfach strafrechtlich relevant beleidigt, und die Plattform löscht den Account trotzdem nicht nach Community Guidelines -, sondern oft sind es anonyme Accounts, die sehr viele Personen strafrechtlich relevant beleidigen, was aber die Beweisführung etwa gegenüber den Sozialen Netzwerken komplizierter macht. Das sollte in den Entwurf aufgenommen werden, um eine sinnvollere Praxisanwendung zu ermöglichen.
Außerdem wäre es sinnvoll, Account-Sperren nicht nur – wie im Entwurf – nur für schwerwiegende Verletzungen des Persönlichkeitsrechts vorzusehen. Auch bei Straftaten wie volksverhetzenden Inhalte oder dem Verwenden von Hakenkreuzen könnten Accountsperren anonymer Hass-Accounts helfen. Diese Straftatbestände sollten aufgenommen werden.
Leider könnte aber die erhoffte „generalpräventive Wirkung“, die drohende Account-Sperren erzeugen sollen, dadurch geschmälert werden, dass bei den meisten Sozialen Netzwerken ein neuer Account sehr schnell erstellt ist. Oft wird Hass von Accounts mit wenig Vernetzung und Followern verbreitet, die extra dafür angelegt wurden – ihr Verlust ist einkalkuliert. Auch eine Sperrung von IP-Adressen kann umgangen werden. Eine deutlichere Präventionswirkung könnten Accountsperren dagegen auf Plattformen darstellen, bei denen Accounts mit Spielständen oder Käufen verknüpft sind – wie etwa bei Gaming-Plattformen. Wenn diese unter das neue Gesetz fielen, könnte das eine erste gute Strategie gegen Hate Speech und digitale Gewalt auf Gaming-Plattformen sein, die bisher irritierenderweise nicht unter das NetzDG gefallen sind. Dies ist aber noch unklar.
3. Erleichterung der Zustellung
Die Praxis der inländischen Zustellungsbevollmächtigten hat sich aus unserer Perspektive bewährt, obwohl sie bisher nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz nur für einen kleinen Teil der möglichen Aufgaben einer solchen Stelle zuständig war. Trotzdem hat dies zivilrechtliche Klagen oder behördliche Verfahren deutlich vereinfacht und beschleunigt. Wir begrüßen deshalb, dass diese Struktur trotz Ablösung des NetzDG durch den DSA nicht nur erhalten bleiben soll, sondern das die inländischen Zustellungsbevollmächtigten auch erweiterte Kompetenzen erhalten. Wobei es bestimmt eine sinnvolle Überlegung wäre, die Einrichtung von Zustelllungsbevollmächtigten in den einzelnen EU-Ländern auch im DSA festzuschreiben.
4. Ergänzungen und Ideen
„Digitale Gewalt“ wird im Eckpunktepapier nicht definiert – u.a. kommen Mobbing und Stalking, aber auch Identitätsmissbrauch und Identitätsdiebstahl vor. Oder es werden Umschreibungen verwendet: „massiv beleidigt“, „verleumdet“, „das Leben bedroht“. Eine Definition wäre hilfreich.
Leider verliert das Eckpunktepapier – anders als bei der ersten Erwähnung eines möglichen Gesetzes gegen digitale Gewalt im Koalitionsvertrag der Bundesregierung – kein konkretes Wort über die Unterstützung und Einrichtung zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen für Opfer digitaler Gewalt. Dies wäre aber eine sehr sinnvolle Maßnahme, um Opfern überhaupt zu ermöglichen, sich im Gefahrenfall schnell zu schützen und ihre Rechte – auch juristisch – wahrzunehmen, weil sie über Handlungsmöglichkeiten informiert werden können. Statt eine Doppelstruktur aufzubauen, könnten bisherige Einrichtungen der Opferberatung und Opferhilfe qualifiziert und fortgebildet werden – besonders die Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt, Mobile Beratungsteams und Beratungsstellen zu misogyner oder queerfeindlicher Gewalt oder Verschwörungsideologien sowie als „Ersthelfer“ Meldestellen für Hass im Netz oder Monitoring-Stellen wie die Meldestelle Antifeminismus wären dafür gut geeignet.
Um aber nicht nur an Symptomen zu arbeiten, sondern auch substantiell die Informations- und Medienkompetenz in Deutschland zu stärken, wäre es wünschenswert, die Bundesländer anzuregen, die Lehren zur Informationskompetenz in Schullehrpläne aufzunehmen.
Um dem digitalen Gewaltschutzgesetz mehr Wirkung zu verleihen, müssten zudem noch praktische Hürden für Betroffene bearbeitet werden – etwa gedeckelte Gebühren und Gerichtskosten bei Auskunftsersuchen, um Verfahren finanziell zu ermöglichen.
Bei Delikten des Persönlichkeitsrechts sollten zivilgesellschaftliche Organisationen Betroffene unterstützen oder an ihrer Stelle klagen können (Verbandsklagerecht). Außerdem wünschenswert wäre eine Regelung zur Kostentragung und Deckelung der Streitwerte, um Betroffenen überhaupt ein Verfahren für ein Auskunftsersuch oder eine Accountsperre zu ermöglichen.
Weitere konkrete Schutzmaßnahmen für Opfer digitaler Gewalt wären eine Reform der „ladungsfähigen Adresse“ für das Impressum von Websites – hier müsste bundesweit geregelt werden, auch Anwält*innen, Trägervereine oder Co-Working-Spaces als ladungsfähige Adressen angeben zu können, um nicht die eigene (Privat-)Adresse verwenden zu müssen. Dies ist bereits gute Praxis in einigen Bundesländern und könnte bundesweit übertragen werden.
Die Verbesserung von Auskunftssperren im Melderegister hat Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden – doch bisher bemerken Betroffene keine Erleichterung in den Verfahren, die weiterhin langwierig und hochschwellig sind – eine Neuregelung wäre wünschenswert.
Und nicht zuletzt brauchen wir Beratung und Empowerment für die demokratischen Stimmen großer Institutionen, Organisationen, Verbände, Projekte oder Medien, die aus Angst vor digitem Hass online noch viel zu leise und zögerlich sind, wenn es darum geht, für demokratische Werte einzutreten – sei es durch Postings oder bei der Kommentar-Moderation. Projekte wie „Civic.net – Aktiv gegen Hass im Netz“ der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin haben bereits viel Expertise zusammengetragen, wie eine demokratische, konstruktive und erkenntnisbringende Debattenkultur gestärkt werden kann, ohne sich selbst und andere in Gefahr zu bringen.

](https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2025/02/Reaktionaere-Wende-20251.png)