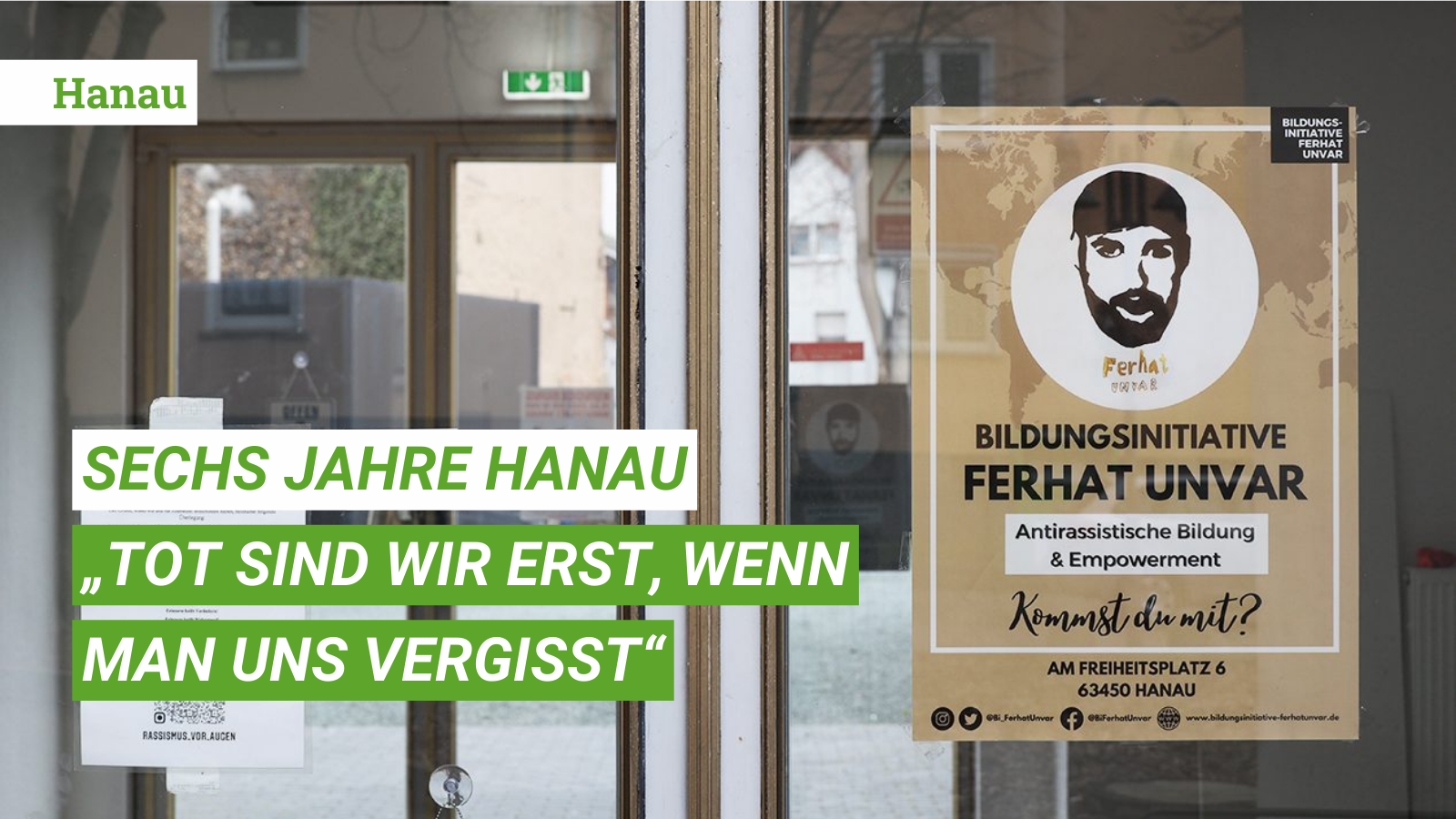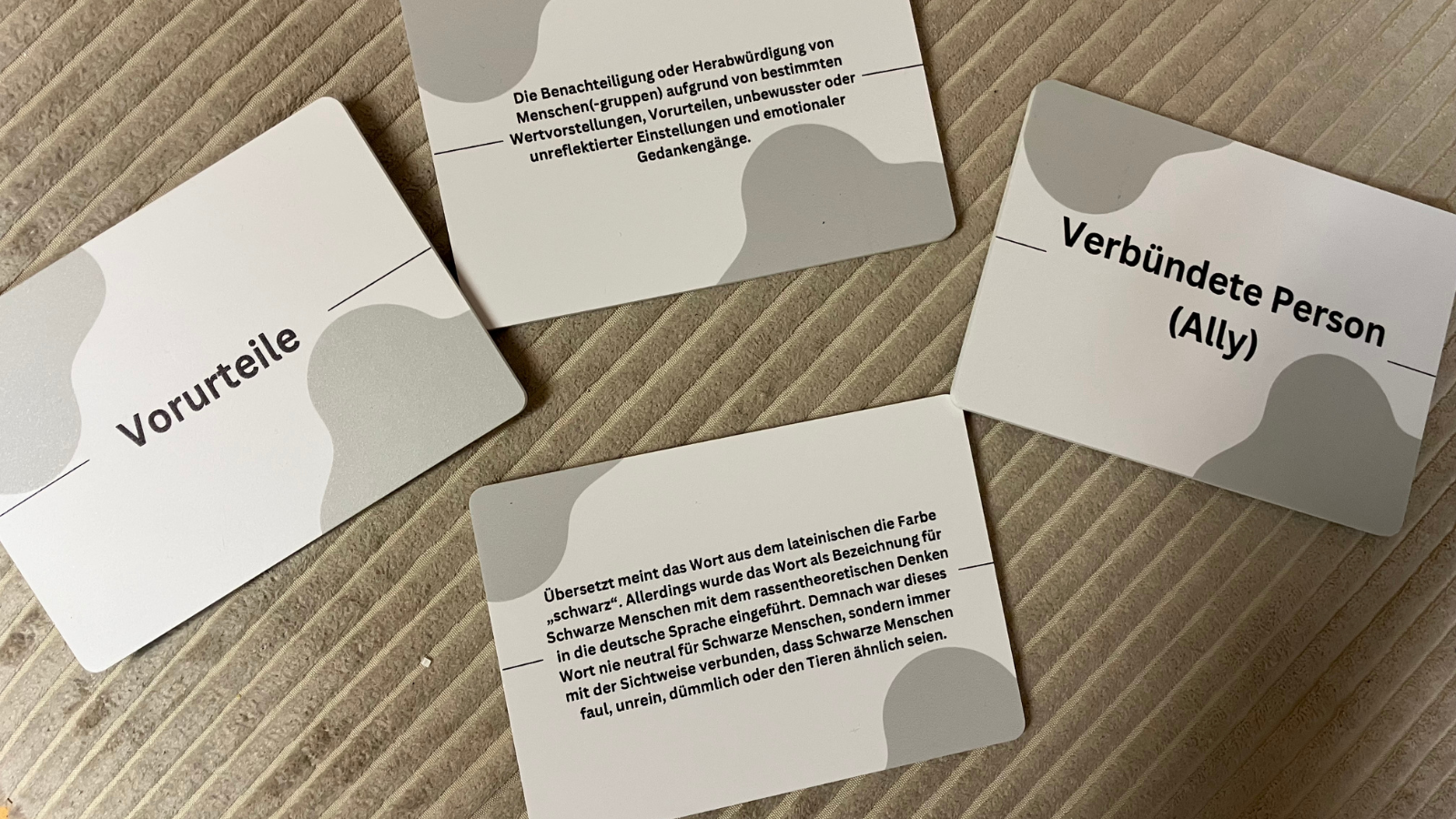Tahera Ameer im Interview: „Das gesellschaftliche Bewusstsein dafür, dass es Rassismus in Deutschland gibt, ist stark gestiegen. Das ist ein Schritt vorwärts, dazu hat die Amadeu Antonio Stiftung beigetragen. Bis praktische Maßnahmen umgesetzt werden, die Rassismus als strukturelles Problem bekämpfen, ist es noch ein weiter Weg. Wir brauchen Proviant und Ausdauer für einen Marathon, nicht für einen Sprint.“
Warum ist es so schwer, Rassismus zu bekämpfen?
Deutschland ist ein Einwanderungsland – das ist seit Jahrzehnten Realität. Trotzdem haben wir als Gesellschaft kein geteiltes Verständnis von dem Begriff „Einwanderungsgesellschaft“: Damit sind nicht die eingewanderten Personen und ihre Communitys gemeint, sondern die Gesellschaft insgesamt. Ohne dieses umfassende Verständnis bleibt Rassismus immer das Problem der Anderen.
Wie lässt sich das ändern?
Um überhaupt antirassistisch handeln zu können, muss man lernen zu differenzieren. Unterschiede unsichtbar zu machen und ganze Gruppen gleichzusetzen, sind Strategien der deutschen Rechten, die mit Rassismus Stimmung gegen die angeblich homogene Masse der Einwander*innen macht. Solch pauschalisierende Aussagen und rassistische Hetze verfangen bis weit in die Mitte der deutschen Gesellschaft. Doch es ist gefährlich, Differenzen und innermigrantische Konflikte zu negieren. Und es ist ja nicht so, dass präzises und fundiertes Wissen schwächen würde. Im Gegenteil, es stärkt.
Wie zeigen sich die Widerstände gegen Antirassismus noch?
Zu Anfang war die Amadeu Antonio Stiftung immer mit dem Vorwurf konfrontiert, ganze Kommunen zu verunglimpfen, indem sie Rechtsextremismus sichtbar macht. Dabei könnten Verantwortungsträger*innen, lokale Bevölkerung und Zivilgesellschaft sich ja auch selbst gegen Rechtsextremismus engagieren und diejenigen unterstützen, die für eine demokratische Kultur und den Schutz von Minderheiten eintreten. Sie könnten die Probleme offen benennen, anstatt der vorherrschenden Meinung zu folgen und damit in dem vermeintlichen Zwang zu stehen, sie verteidigen zu müssen. Diese Abwehr und auch die Opferrolle, in die man sich begibt, kann kein identitätsstiftendes Konzept sein, mit dem wir die demokratische Kultur stärken. Damit können wir weder Opfer von Rassismus und Rechtsextremismus unterstützen noch den Artikel 3 des Grundgesetzes verwirklichen.
Welche Probleme gibt es noch?
Der Kampf gegen Rassismus wird stark vereinnahmt. Wenn wir wirklich konsequent antirassistisch handeln wollen, dürfen wir es nicht dem türkischen Nationalismus oder dem politischen Islam durchgehen lassen, wenn sie im Namen eines antirassistischen Anliegens versuchen, ihre antidemokratische Agenda umzusetzen. Aus lauter Angst vor einem Rassismusvorwurf, Täter*innen nicht als Täter*innen zu benennen, zeigt doch nur, dass diese Gesellschaft keinen sicheren Umgang im Erkennen und Benennen von Rassismus hat. Stattdessen werden alle von Rassismus betroffenen Menschen zu einer homogenen Gruppe von Opfern gemacht. Wir können es uns als Gesellschaft aber nicht leisten, wegzugucken, denn innermigrantischer Rassismus bedeutet eine alltägliche, teils tödliche Bedrohung für die Minderheiten innerhalb der Minderheiten.
Wie würde antirassistisches Handeln aussehen?
Ein konsequenter Antirassismus muss klar benennen und jenseits dieser Vereinnahmungen stattfinden. Die aktuelle Polarisierung stellt ein enormes Problem dar. Differenzierung und Konflikt werden auf beiden Seiten als Schwäche empfunden und nicht als Chance.
Sind wir als Gesellschaft dafür bereit?
Unsere Gesellschaft ist in großen Teilen noch weit davon entfernt, sich einen Begriff von der ganz konkreten Bedeutung von Rassismus für den Alltag und das Leben von Betroffenen zu machen. Täglich kommt es zu rassistischen Übergriffen, ohne dass die Mehrheit sich davon betroffen oder angesprochen fühlt. Die Ausdifferenzierung in die verschiedenen Rassismen und ihre jeweiligen historischen Ursprünge und Ausformungen sind eine große Herausforderung für eine Gesellschaft, die gerade erst begonnen hat, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen.
Wie unterstützt die Amadeu Antonio Stiftung diesen Prozess?
Zunächst ist Sichtbarkeit das Wichtigste. Dafür haben wir zusammen mit KURD-AKAD und anderen von innermigrantischem Rassismus betroffenen Wissenschaftler*innen und Expert*innen 2023 die Konferenz „Doppelt unsichtbar“ veranstaltet und 2024 den dazugehörigen Sammelband herausgebracht.
Welche Überzeugung steht dahinter?
Es muss jedem Menschen, der in seiner Differenz wahrgenommen werden will, möglich sein, ohne Angst verschieden und so überhaupt erst sichtbar zu sein, ohne Angst vor Instrumentalisierung. Die Amadeu Antonio Stiftung will alle Menschen, deren rassistische Gewalterfahrungen unsichtbar gemacht werden, darin unterstützen, den innermigrantischen Rassismus aufzudecken und ihm etwas entgegenzusetzen.
Wie zeigt sich, dass struktureller Rassismus ignoriert wird?
Wir haben kaum Repräsentation in den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären, keine Lobby, die sich dafür stark macht, die strukturellen Verhältnisse genau anzuschauen und zu verändern. Es gibt keinen politischen Willen, über die Bereitstellung von Ressourcen zu diskutieren, um zum Beispiel eine systematische paritätische Job-Besetzung anzustoßen oder die besonderen Bedarfe von Personen anzuerkennen, die von Rassismus betroffen sind.
Wie lässt sich das verändern?
Selbstverpflichtung, Aufklärung und Bildungsarbeit müssen vorangetrieben werden – alle Bereiche der Gesellschaft können das aktiv mitgestalten. Medien, Behörden, Unternehmen, Schulen, jede Institution könnte sich etwa selbst dazu verpflichten, dem Grundgesetz sowie den Anforderungen, vor die uns die Zusammensetzung unserer Gesellschaft stellt, nachzukommen. Allein die Frage zu beantworten: „Was ist mein Einflussbereich, in dem ich konkrete Veränderungen anstoßen kann, und wie tue ich das?“, wäre ein Quantensprung, obwohl wir da ja noch nicht mal bei Fragen der Umsetzung sind.
Im letzten Lagebild der Regierung von 2023 sagen 90 Prozent der Befragten, dass es Rassismus in Deutschland gibt.
Es gibt heute eine größere Wahrnehmung davon, dass Rassismus existiert, ja. Auch seine verschiedenen Facetten sind sichtbarer geworden, also Anti-Schwarzer Rassismus, Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja, antikurdischer Rassismus, antiasiatischer Rassismus, um nur einige zu nennen. Deswegen sind wir heute eher in der Lage, die spezifische Betroffenheit von Personen überhaupt wahrzunehmen.
Es hat sich also doch etwas geändert?
Aber klar! Es gibt sehr viele Initiativen und Organisationen, die ihre Anliegen, ihre Wut, ihre Visionen und ihre konkreten Ideen für eine bessere Gesellschaft als Betroffene und Expert*innen von Rassismus laut äußern, die Forderungen stellen und unsere Gesellschaft verändern. Außerdem gab es in der letzten Legislaturperiode die erste Antirassismusbeauftragte des Bundes, es gibt eine Antidiskriminierungsbeauftragte, einen Antiziganismusbeauftragten. Es gibt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das vor Diskriminierung durch Rassismus schützt. Wir haben gesellschaftlich einiges erreicht. Ich bin stolz darauf, dass die Amadeu Antonio Stiftung durch ihre Arbeit Teil dieses gesellschaftlichen Fortschritts ist. Wie es damit weitergeht, steht auf einem anderen Blatt.
Was ist zu befürchten?
Wir erleben starken Widerstand von Menschen, die, anders als noch vor einigen Jahren, sehr laut sagen: Wir wollen eine homogene Gesellschaft. Wer da nicht reinpasst, muss sich extrem konform und leistungsstark verhalten, sonst haben wir als Gesellschaft kein Interesse daran. Das widerspricht im Kern dem Gleichwertigkeitsgedanken, wie er im Grundgesetz festgeschrieben ist. Nur mit einem solchen (menschenfeindlichen) Mindset kann man darüber reden, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, oder gleich „Remigration“ fordern.
Die Amadeu Antonio Stiftung sticht ja auch deswegen heraus, weil sie sowohl Antisemitismus als auch Rassismus bekämpft.
Seit dem 7. Oktober 2023 kommt Antisemitismus viel öfter im Mantel der Rassismuskritik daher, Jüdinnen*Juden stehen nahezu ohne jegliche Solidarität da. Wer sich gegen Rassismus und gegen Antisemitismus engagiert, sollte von sich verlangen, das andere immer auch im Blick zu haben.
Was heißt das für die Amadeu Antonio Stiftung?
Als Stiftung verpflichten wir uns dazu, denen zur Seite zu stehen, die mit ihrer Bedrohungssituation kaum sichtbar und extrem marginalisiert sind. Das gilt leider unverändert – und seit dem 7. Oktober schlimmer denn je – für alle von Antisemitismus Betroffenen. Es gilt aber auch für Palästinenser*innen, die die Hamas nicht als Befreiungs- und Widerstandsorganisation betrachten, sondern als das, was sie ist: eine Terrororganisation, die nur auf Vernichtung aus ist. Als Stiftung nehmen wir es uns zur Aufgabe, Diskriminierungen, die von vielen gar nicht als Problem wahrgenommen werden, aufzuzeigen.
Was bedeutet das für Betroffene?
Fakt ist: Betroffene von Rassismus sind nicht alle gleich betroffen. Gruppen wie Kurd*innen, Alevit*innen oder Armenier*innen werden in der deutschen Mehrheitsgesellschaft als türkisch gelesen und diskriminiert und zugleich von türkischen Nationalist*innen diffamiert. Oder etwa Ezid*innen, die als muslimisch gelesen, aber vor allem von nationalistischen und rechtsextremen Muslim*innen bedroht werden. All diese Menschen leben als Minderheit innerhalb einer Minderheit. Solange wir als Gesellschaft nicht bereit sind, genau hinzuschauen und zu begreifen, dass eine Bedrohung u. a. von der organisierten türkischen Rechten ausgeht, kann die Demokratie ihrem Versprechen, Minderheiten zu schützen, nicht nachkommen.
Der Artikel erschien ursprünglich bei Belltower.News.