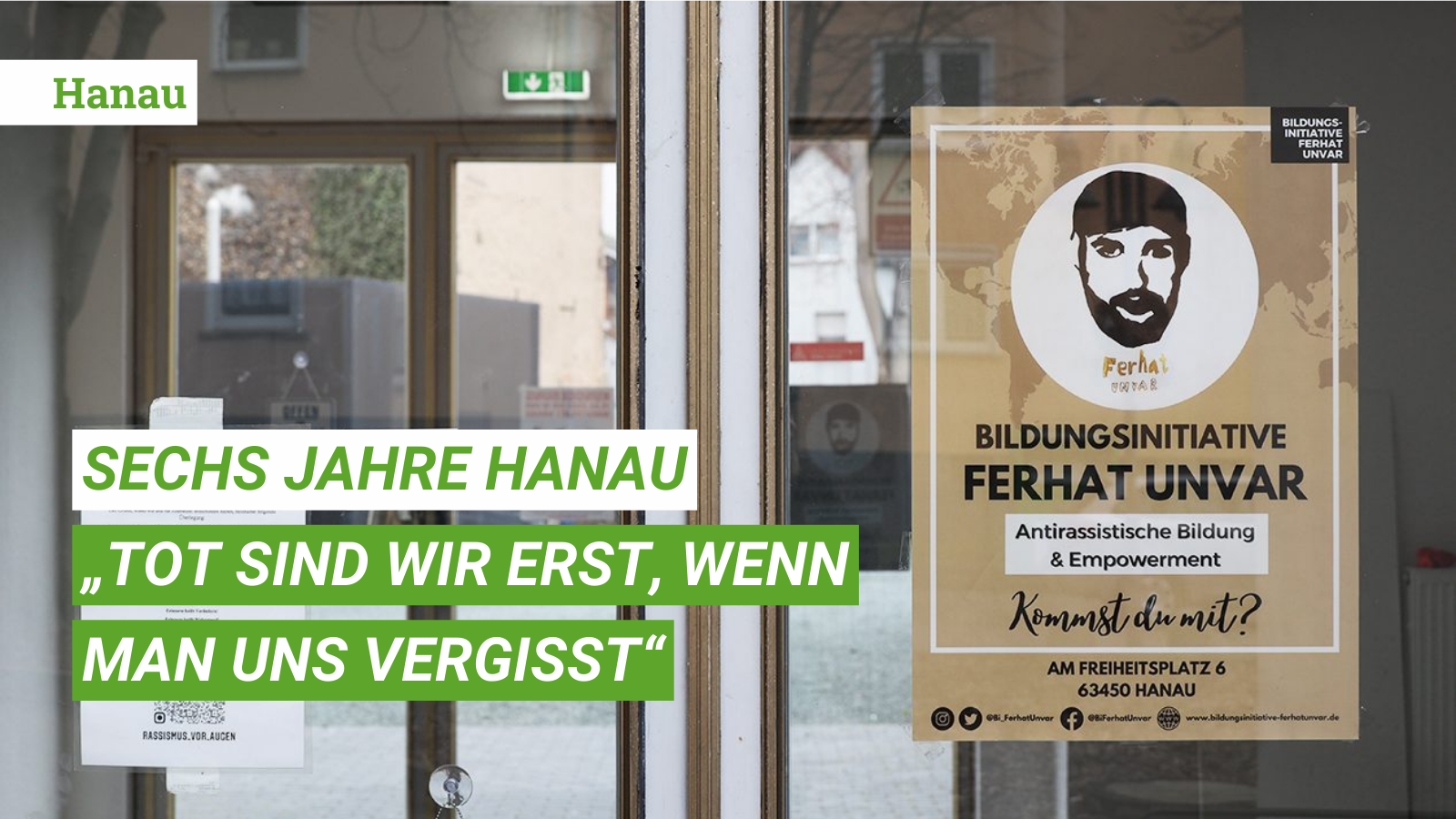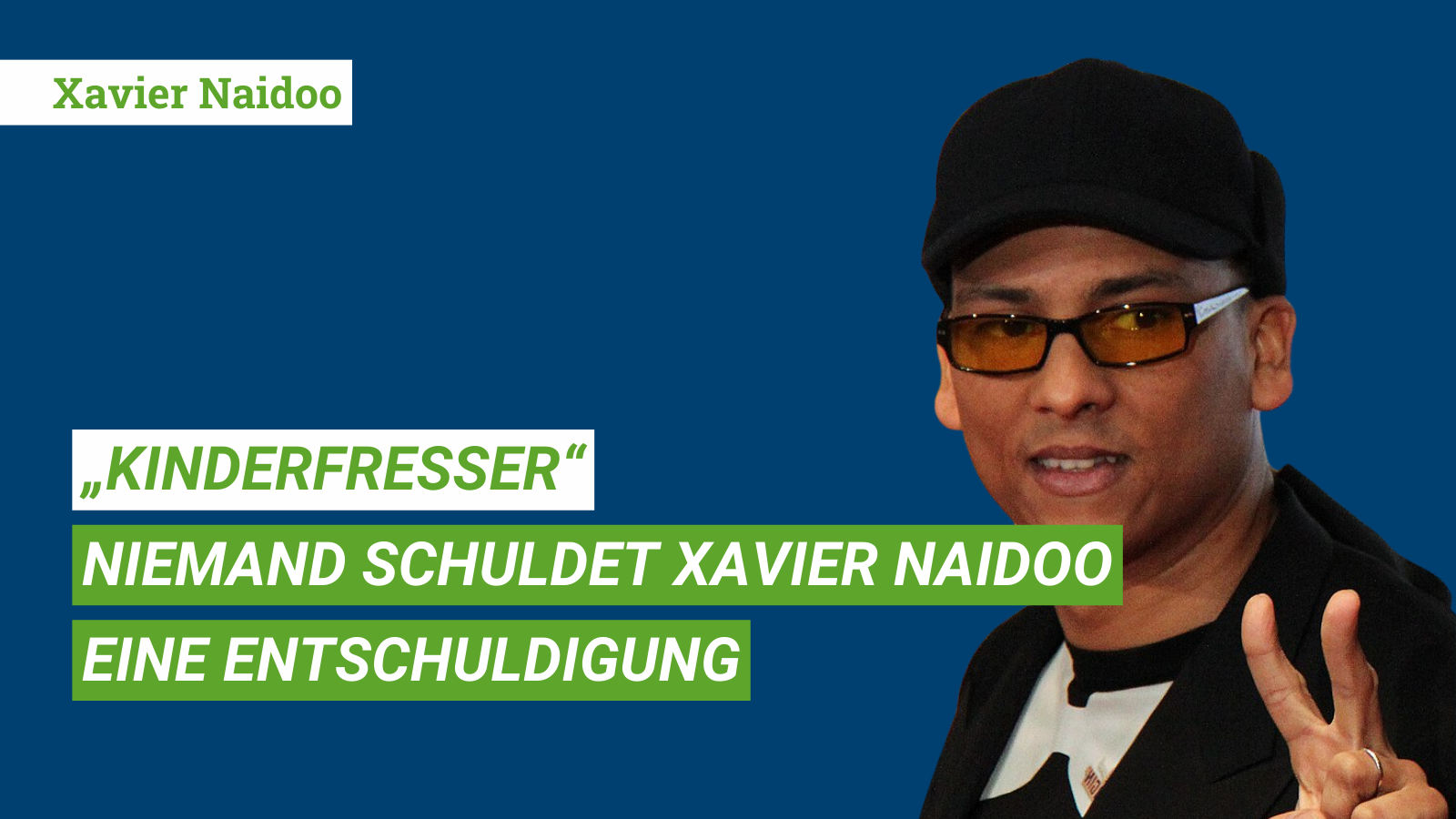Akute psychologische Unterstützung, die Reparatur von eingeschlagenen Fenstern oder Anwaltskosten bei einer Nebenklage – der Berliner Soforthilfefonds unterstützt seit Juni 2021 Betroffene von Hassgewalt finanziell. Der Bedarf ist groß.
Niedrigschwellig und schnell soll sie sein, die Unterstützung für Menschen, die Hassgewalt erlebt haben. Finanziert über die Landeskommission Berlin gegen Gewalt, konnte der Berliner Soforthilfefonds im Sommer 2021 seine Arbeit aufnehmen, um dort Unterstützung zu leisten, wo sie dringend gebraucht wird. Neben der finanziellen Soforthilfe bieten die Kolleg:innen vom Soforthilfefonds eine Beratung zur Antragstellung an. “In der Beratung überlegen wir gemeinsam, welche Maßnahmen hilfreich sein könnten und für einige ist es eine Erleichterung, den Antrag nicht alleine ausfüllen zu müssen” berichtet Aurélie Wallaschkowski vom Projekt.
Einen Antrag auf Soforthilfe in Höhe von bis zu 1.000 Euro können Menschen stellen, die aus vorurteilsmotivierten oder abwertungsideologischen Motiven (rassistisch, antisemitisch, Roma-feindlich, LSBTI*-feindlich, sexistisch, obdachlosenfeindlich etc.) angegriffen oder bedroht werden. Dies gilt ebenfalls für Personen, die sich für menschenrechtliche und demokratische Grundsätze einsetzen und deshalb Gewalt erfahren.
Die Motive sind vielfältig – Betroffene berichten von rassistisch motivierten Angriffen in der U-Bahn, rechten Bedrohungen wegen ihrer journalistischen Arbeit, von trans*-feindlichen Beleidigungen bis hin zu Drohungen auf der Straße. So erging es auch F. und C. als sie an einem Abend zusammen in einer Bar sitzen und sich unterhalten. Sie bemerken, dass Personen am Nachbartisch anfangen lautstark über sie zu sprechen und sie rassistisch und trans*-feindlich zu beleidigen. F. und C. beschweren sich und bitten darum, das zu unterlassen. Doch stattdessen kommt einer der Personen rüber, bespuckt C. und versucht C. zu schubsen. Die Täter:innen in diesem Fall werden erst nach mehrmaligem Erbeten aus der Bar geworfen.
74 Anträge hat der Soforthilfefonds seit dem Sommer 2021 erhalten. Besonders auffällig ist die hohe Anzahl an rassistischen, trans- und homo-feindlichen sowie sexistisch/antifeministisch motivierten Vorfällen. In über der Hälfte der Fälle wurden Menschen aus rassistischen Motiven angegriffen oder bedroht, dabei handelte es sich mehrheitlich um Anti-Schwarzen Rassismus. Bei einem Viertel der Fälle war das Motiv LSBTI-Feindlichkeit zu erkennen. Hier waren die Angriffe und Bedrohungen an trans* femininen Personen besonders häufig. Wichtig ist insgesamt zu erkennen, dass in vielen Fällen die Motive bzw. Diskriminierungsformen intersektional auftreten – das heißt, dass sich verschiedene Diskriminierungsformen überschneiden. Unter den LSBTI-feindlichen Fällen sind die Hälfte ebenfalls rassistisch motiviert und auch antifeministische oder sexistische Motive treten häufig auf.
Die Motive von Hassgewalt sind vielfältig und so auch die Erfahrungen und Bedarfe der Betroffenen. So wurde beispielsweise aufgrund eines körperlichen Angriffs in der U-Bahn ein Fahrrad beantragt, um öffentliche Verkehrsmittel meiden zu können. In einem Fall von rechten Bedrohungen wegen ihrer journalistischen Arbeit, war eine Betroffene auf Gelder für Rechtsberatung angewiesen und in weiteren Fällen von rassistischen und antifeministischen Drohungen auf der Arbeit wurde akute psychologische Unterstützung benötigt. Viele Menschen haben Hassgewalt im öffentlichen Raum erfahren – auf der Straße, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Bars und Restaurants. Es wurde sehr deutlich, dass Gewalt auch im eigenen Zuhause passiert, wenn etwa Nachbar:innen oder Mitbewohner:innen übergriffig werden, die Adresse gedoxxt (im Internet veröffentlicht) oder der Wohnraum zerstört wurden. Auch gab es viele Fälle am Arbeitsplatz sowie im digitalen Raum. Ein besonders hoher Bedarf hat sich für psychologische Unterstützung, medizinische Behandlungen und Körpertherapie sowie Rechtsberatung und Anwaltskosten herausgestellt.
Auch im Fall von F. und C. zeigte sich ein Bedarf an Unterstützung. C. wird über eine befreundete Person auf den Berliner Soforthilfefonds aufmerksam gemacht und geht zur Beratung beim Soforthilfefonds. Gemeinsam ermitteln sie, dass C. sich gerne anwaltlich beraten lassen möchte, um zu schauen, ob sie rechtlich gegen die Täter:innen vorgehen kann und beantragt zudem ein paar Stunden, um eine akute psychologische Unterstützung zu bezahlen, um das Erlebte besser zu verarbeiten. Viele der Antragstellenden nehmen eine Beratung beim Soforthilfefonds in Anspruch, bevor sie einen Antrag stellen, es ist aber auch möglich, einen Antrag nach einer Beratung bei einer anderen Berliner Beratungsstelle zu stellen.
“Die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen, die psychosoziale oder rechtliche Beratung anbieten, ist für uns sehr wichtig, um Betroffene besser zu erreichen. Es hat sich gezeigt, dass der Berliner Soforthilfefonds eine Leerstelle in der niedrigschwelligen und finanziellen Unterstützung von Betroffenen ausfüllt”, erzählt Aurélie Wallaschkowski.
Neben der finanziellen Komponente ist dies auch der Ausdruck von gesellschaftlicher Solidarität mit den Betroffenen. Vertraulichkeit, Parteilichkeit und Solidarität sind Grundpfeiler des Soforthilfefonds. Auch 2022 wird der Soforthilfefonds Betroffene von Hassgewalt unterstützen können. Ziel ist es, das Angebot weiter zu streuen und auch andere Betroffenengruppen besser zu erreichen, erklärt Aurélie Wallaschkowski: “Wir mussten feststellen, dass wir etwa SintI:zze und Rom:nja, Jüdinnen:Juden und Menschen mit Behinderungen wenig erreicht haben, dabei zeigen die Statistiken sehr deutlich, dass auch diese Gruppen Hassgewalt ausgesetzt sein können.”