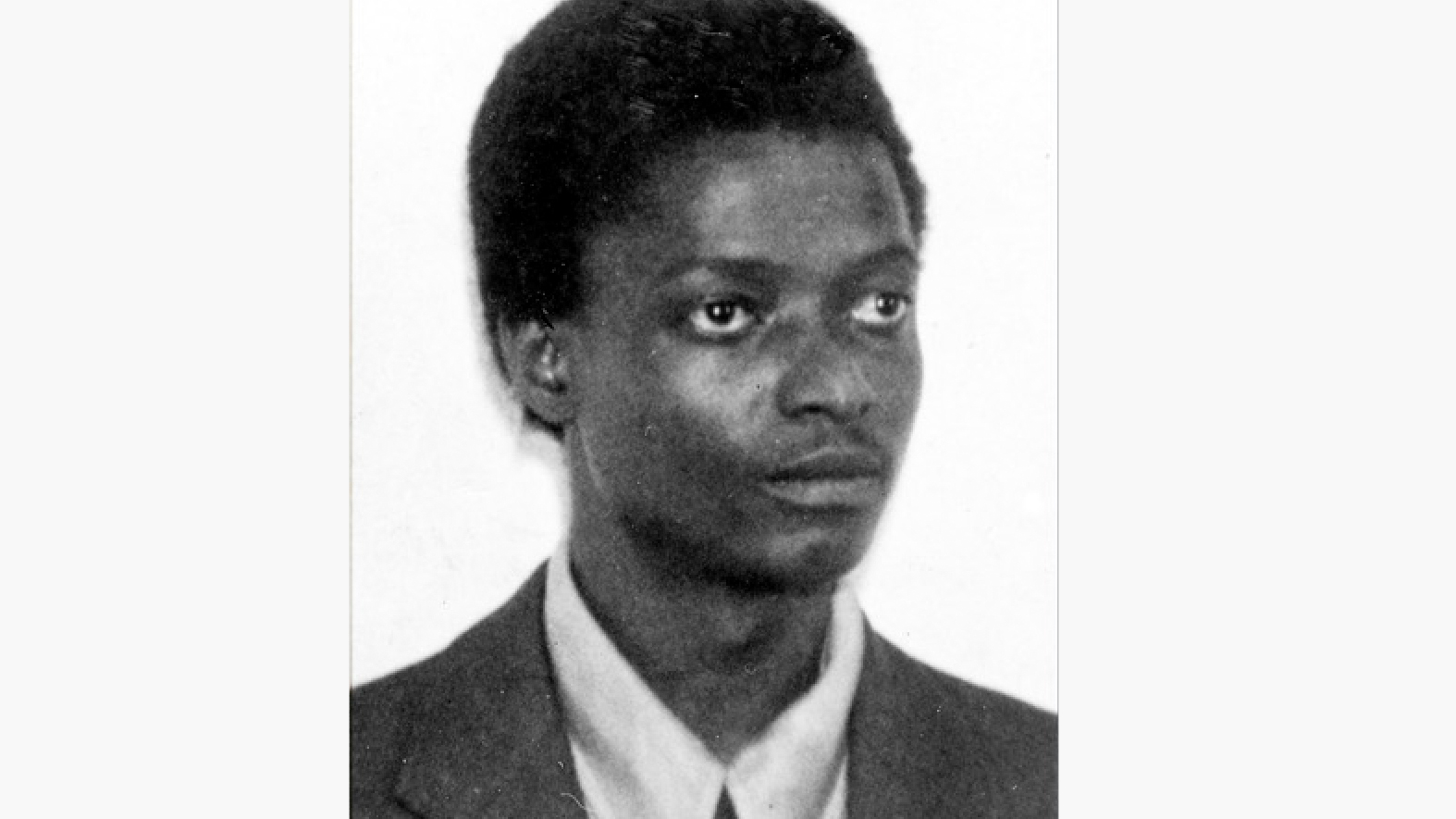Marieta Böttger ist Eberswalderin und war viele Jahre lang zunächst Ausländerbeauftragte, später Integrationsbeauftragte des Landkreises Barnim. Heute engagiert sie sich als Vorsitzende des Vorstandes der Bürgerstiftung Barnim Uckermark. Im Interview berichtet sie über das Klima in Eberswalde nach dem Mord an Amadeu Antonio und was sich seither dort getan hat.
Wie haben Sie in den 90ern die Situation der Menschen wahrgenommen, die in Eberswalde lebten und von Rassismus und rechtsextremen Übergriffen betroffen waren? Was hat die Stadt damals unternommen?
Gleich nachdem ich 1991 meine Arbeit als Ausländerbeauftragte begann, suchte ich Kontakte zu den in Eberswalde lebenden angolanischen und mosambikanischen Vertragsarbeitern und ihren deutschen Partnerinnen.
Das war anfangs schwierig, weil sich alle versteckt hielten und kaum noch auf die Straße trauten. Sie hatten auch große Angst um ihre Kinder, die ja damals noch klein und besonders schutzbedürftig waren. Ich habe es aber mit Ausdauer und Einfühlungsvermögen geschafft, dass mir die Menschen vertrauten. So saß ich z.B. zusammen mit Freunden bei einem deutsch-angolanischen Paar in deren kleiner Wohnung, um ihnen unsere Solidarität zu erweisen, denn auch die beiden hatten schreckliche Angst vor einem Übergriff, den man ihnen für den Tag angedroht hatte. Telefonketten waren reine Theorien, denn Telefonanschlüsse gab es zu der Zeit für die wenigsten. Kein Afrikaner besaß ein Telefon und konnte deshalb auch nicht die Polizei oder andere Hilfe rufen. Viel Zutrauen hatten sie zur damaligen Polizei nicht entwickeln können, fühlten sich eher von der Polizei diskriminiert, denn um nicht völlig zu vereinsamen, trafen sich die Angolaner gerne in ihren Privatwohnungen. Das führte dann zu völlig überzogenen Polizeieinsätzen gegen sie.
Ich habe daraufhin bei der Führungsebene der Polizei nachgehakt und bin auf großes Verständnis gestoßen. Es gab gute Gespräche der Polizei mit einigen Angolanern und daraus resultierend auch erste Abmachungen. Allein der Gedanke, dass die Polizei ihnen helfen wird, hat viele beruhigt. Deutlich wurde aber auch der Wunsch, einen eigenen Treffpunkt zu haben. So entstand die Idee, den Afrikanischen Kulturverein Palanca e.V. zu gründen und sich dafür ein eigenes Domizil zu suchen, was dann 1994 verwirklicht werden konnte.
Da die Stadt keine/n direkte/n Ansprechpartner/in für diese Gruppe von Einwohnern hatte, lief die Kommunikation meist über mich. Ich denke heute, dass die Stadt deutlichere Zeichen hätte setzen können, sei es bei der Wohnungssuche oder aber auch der Frage des Schutzes. Nach dem Amtsantritt von Reinhard Schulz klappte der Kontakt wesentlich besser. Irgendwann gab es auch Zuschüsse für den Verein.
Gleichzeitig stand die Frage im Raum, wie die Stadt mit dieser Tat umgehen soll.
Der In-und AusländerInnenkreis hatte sich im Begegnungszentrum etabliert und gemeinsam setzten wir uns für ein ansprechendes Gedenken an Amadeu Antonio ein. Seit 1995 gibt es diese Tradition. In der gleichen Zeit entstand die Gedenktafel.
Sie haben den Mord an Amadeu Antonio als Bürgerin der Stadt mitbekommen. Hat es Sie damals überrascht, dass so etwas in Eberswalde passieren konnte?
1990 lebte ich bereits 14 Jahre in Eberswalde. Ich hatte mir mit meinem Mann einen kleinen Freundeskreis aufgebaut und arbeitete als Deutsch- und Englischlehrerin, war in der evangelischen Gemeinde ehrenamtlich aktiv und Stadtverordnete der CDU.
Mit Ausländer*innen hatte ich keinen wirklichen Kontakt. Es gab vorher zwar Begegnungsnachmittage mit der damals hier ansässigen sowjetischen Mittelschule, die auf mich aber sehr surreal und nur oberflächlich wirkten. Vorher wurde uns z.B. mitgeteilt, dass es von sowjetischer Seite nicht erwünscht sei, Adressen auszutauschen.
So eine ähnlich gelagerte Begegnung hatte ich auch mit einigen angolanischen Arbeitern, die im Schlacht-und Verarbeitungskombinat Eberswalde, dem Patenbetrieb meiner Schule, beschäftigt waren und im betriebseigenen Jugendklub Musik machten. Bei einer Begegnung fanden wir kaum Worte, um miteinander zu kommunizieren. Ich denke, dass lag nicht nur am fehlenden Wortschatz der Angolaner, sondern auch an unserer inneren Blockade. Es war nichts vorsätzlich Böses, aber wir hatten uns eine distanzierte Haltung zu den jungen Männern zugelegt, vielleicht auch unbewusst, um nicht ins Gerede zu kommen. Außerdem kamen sie aus einer anderen Welt und waren nur auf Zeit hier.
Im Herbst 1990 erlebten wir dann den Aufmarsch junger Rechtsradikaler, die versuchten, den Jugendklub in Finow und den öffentlichen Raum zu besetzen. Ihre Hauptfeinde waren neben den Linken Ausländer. Ich kann mich noch erinnern, dass das damals in der Stadtverordnetenversammlung oft Thema war, insofern war ich nicht völlig überrascht.
Dann erzählte uns eine Kollegin, deren Mann im Krankenhaus arbeitete, von einem schwer verletzten Mann aus Angola. In der Öffentlichkeit hat das meines Erachtens kaum eine Rolle gespielt.
Welche Reaktionen haben Sie anschließend aus der Stadt, der Politik, Medien wahrnehmen können?
Als Amadeu Antonio starb, gab es zunächst keine öffentlichen Reaktionen.
Das Treiben der Neonazis ging noch eine ganze Weile. Sie versuchten, durch Einschüchterung und Lautstärke die Öffentlichkeit zu beeindrucken. Aber dann schlossen sich immer mehr Akteure zusammen, um die Gegenpositionen zu verdeutlichen und gemeinsam zu demonstrieren und mit Jugendlichen nach anderen Wegen zu suchen. Ich war dann ab 1991 als Ausländerbeauftragte auch dabei und habe an der Netzwerkbildung mitgearbeitet. Ein wichtiger Partner war damals das Begegnungszentrum „Wege zur Gewaltfreiheit“ und die evangelische Jugend.
Als es zum Prozess kam, sind immer einige von uns hingegangen. Die Gegenseite war auch vertreten. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass die Täter sich ihrer Sache recht sicher waren. Weil nicht heraus kam, wer dem Opfer die tödlichen Tritte versetzt hat, gab es für alle eher niedrige Strafen.
Das hat die Berliner Antifa auf den Plan gerufen. Zum Abschluss des Prozesses sollte es einen Schweigemarsch geben, der aber völlig aus dem Ruder lief. Polizisten wurden gejagt, und wir Eberswalder*innen standen fassungslos da und konnten nur zusehen.
Was hat sich seither in Eberswalde verändert?
Viele ehemalige Vertragsarbeiter haben Eberswalde leider verlassen, vor allem, weil sie hier keine Arbeit gefunden haben – aber auch, weil sie sich im international und multikulturell geprägten Berlin oder anderen Metropolen freier und sicherer fühlen. Flüchtlinge sind aber dazu gekommen und haben sich teilweise auch bei Palanca e.V. engagiert. Ich denke, dass es inzwischen leichter ist, als Schwarze/r oder als People of Colour in Eberswalde zu leben. Die Betroffenen stehen nicht mehr so alleine da, wie Anfang der 90er Jahre. Es gibt zivilgesellschaftliche Netzwerke, mehr Beratungsstrukturen, einige Migrant*innenselbstorganisationen. Das Antidiskriminierungsgesetz hat etliche Stellschrauben angezogen und einiges verändert. Auch die Politik ist inzwischen offener und erkennt die Probleme.
Es gibt aber immer wieder auch Rückschritte und mühsame Neustarts. Fehlverhalten einzelner werden immer wieder der gesamten Community zugerechnet, der Ruf nach der Polizei wird wieder lauter, auch von Seiten der Stadt.